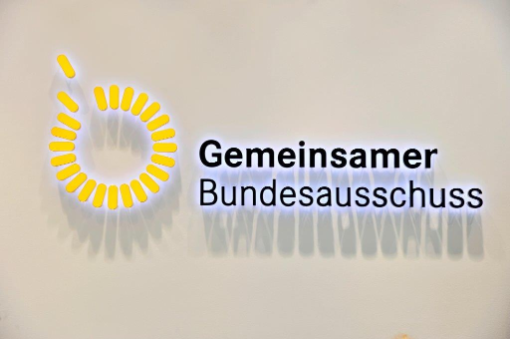
Qualitätssicherung

Mindestmengen sind ein wichtiges Instrument der Qualitätssicherung in der stationären Versorgung und sollen gewährleisten, dass besonders komplexe und anspruchsvolle medizinische Leistungen nur von Krankenhäusern erbracht werden, die über ausreichende Erfahrung und Kompetenz verfügen. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) legt bundesweit für planbare stationäre Leistungen Mindestmengen fest, bei denen ein nachweisbarer Zusammenhang zwischen der Anzahl der durchgeführten Eingriffe und der Behandlungsqualität besteht. Der G-BA hat bislang für 12 Leistungen bundesweit verbindliche Mindestmengen festgelegt, die qualitätssichernd auch für Krankenhäuser im Land gelten.
Mindestmengen sichern Versorgungsqualität
Die wichtigsten Mindestmengen und ihre Anforderungen umfassen unter anderem:
- Lebertransplantation (inklusive Teilleber-Lebendspende): mindestens 20 Eingriffe pro Standort
- Nierentransplantation (inklusive Lebendspende): mindestens 25 Eingriffe
- Komplexe Eingriffe an der Speiseröhre (Ösophagus): mindestens 26 Eingriffe
- Komplexe Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse (Pankreas): mindestens 20 Eingriffe
- Stammzelltransplantation: mindestens 40 Eingriffe
- Kniegelenk-Totalendoprothesen (Knie-TEP): mindestens 50 Eingriffe
- Versorgung von Früh- und Reifgeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 1.250 Gramm: mindestens 25 Behandlungen
- Chirurgische Behandlung von Brustkrebs (Mamma-Ca): mindestens 100 Eingriffe
- Thoraxchirurgische Behandlung von Lungenkarzinomen: mindestens 75 Eingriffe
- Herztransplantation: Übergangsregelung bis 2026, aktuell keine Mindestmenge für 2024 und 2025 (10 ab 1.1.2026)
- Operationen am Dickdarm (Kolonkarzinom): gestaffelte Mindestmengen mit Übergangsregelungen bis 2029
- Operationen am Enddarm (Rektumkarzinom): gestaffelte Mindestmengen mit Übergangsregelungen bis 2029
Auch für Mecklenburg-Vorpommern bedeutet dies, dass nicht alle Kliniken die qualitätssichernden Mindestmengen gerade bei besonders komplexen Eingriffen erreichen, was schon in der Vergangenheit eine Konzentration der Leistungen im Land zur Folge hatte. Wenngleich im Einzelfall dadurch Wege weiter werden, können die Patientinnen und Patienten auf Erfahrung der sie behandelnden Teams und eine entsprechend hohe Qualität setzen, die Leben sichert und Krankheitsverläufe positiv beeinflusst.
Mit Einführung der Leistungsgruppen im Rahmen der Umsetzung der Krankenhausreform sind weitere, die Qualität sichernde, Angebotsoptimierungen im Land zu erwarten, wie auch das zuständige Ministerium bereits in Aussicht stellt.
Wissenswertes
Die Festlegung von Mindestmengen in Krankenhäusern erfolgt durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA), das höchste Entscheidungsgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. Ziel dieser Regelung ist es, die Behandlungsqualität zu sichern und zu verbessern.
Grundlage ist die wissenschaftlich belegte Erkenntnis, dass bei bestimmten komplexen Eingriffen die Erfahrung des Behandlungsteams und die Routine der Einrichtung maßgeblich für den Behandlungserfolg sind. Der G-BA prüft daher regelmäßig, für welche Leistungen ein Zusammenhang zwischen Fallzahl und Ergebnisqualität besteht.
Wenn dieser Zusammenhang ausreichend belegt ist, legt der G-BA für die betreffende Leistung eine jährliche Mindestfallzahl fest, die ein Krankenhaus erreichen muss, um die entsprechende Leistung abrechnen zu dürfen. Beispiele sind Transplantationen, bestimmte Krebsoperationen oder komplexe Eingriffe am Herzen. Krankenhäuser, die die festgelegte Mindestmenge nicht erreichen, dürfen diese Leistungen in der Regel nicht mehr erbringen, es sei denn, sie erfüllen besondere Ausnahmeregelungen (z. B. im Rahmen der Versorgungssicherung).
Über Mindestmengen in Krankenhäusern entscheidet der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA).
Der G-BA ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen. In ihm sind die Krankenkassen (GKV-Spitzenverband), die Krankenhaus- und Ärzteverbände sowie unabhängige Patientenvertreter vertreten. Den Vorsitz führt ein unparteiischer Vorsitzender.
Der G-BA legt auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und Datenanalysen fest, für welche Leistungen ein Zusammenhang zwischen Behandlungsmenge und -qualität besteht. Wenn dies nachweisbar ist, beschließt der G-BA eine Mindestmenge, die Krankenhäuser pro Jahr erbringen müssen, um die betreffende Leistung weiterhin abrechnen zu dürfen.
Die Rechtsaufsicht über diese Entscheidungen führt das Bundesministerium für Gesundheit (BMG), das Beschlüsse des G-BA überprüfen und bei Bedarf beanstanden kann.
Eine Ausnahmegenehmigung bei Mindestmengen ermöglicht es einem Krankenhaus, bei Vorliegen konkreter und relevanter Ausnahmekriterien bestimmte Leistungen trotz Nichterreichens der festgelegten Mindestfallzahl weiterhin zu erbringen. Dabei gilt, dass eine Ausnahme eine Ausnahme sein muss.
Wann ein Ausnahmeantrag relevant wird
Ein Ausnahmeantrag wird relevant, wenn ein Krankenhaus eine Leistung anbietet, für die der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) eine Mindestmenge vorgeschrieben hat (z. B. komplexe Operationen oder Transplantationen), das Krankenhaus aber nicht (mehr) die erforderliche Zahl an Fällen pro Jahr erreicht. Ohne Ausnahmegenehmigung dürfte das Krankenhaus diese Leistung nicht mehr abrechnen.
Wer sie beantragt
Die Krankenhäuser selbst stellen den Antrag auf Ausnahmegenehmigung bei der zuständigen Landesbehörde. In Mecklenburg-Vorpommern handelt es sich hier um das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport. Das Ministerium leitet den Antrag an die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen weiter, da eine Ausnahme nur möglich ist, wenn die gesetzlichen Krankenkassen dem Antrag zustimmen.
Was danach geschieht
Die Landesverbände der Krankenkassen und die Ersatzkassen prüfen den Antrag verantwortungsbewusst. Sie teilen dem Ministerium im Anschluss mit, ob sie – häufig befristet – eine Ausnahme erteilen, oder diese ablehnen. Diese Entscheidung wird regelmäßig überprüft. Krankenhäuser müssen dabei häufig Qualitätsberichte oder Nachweise vorlegen, dass sie die Leistung sicher erbringen können.
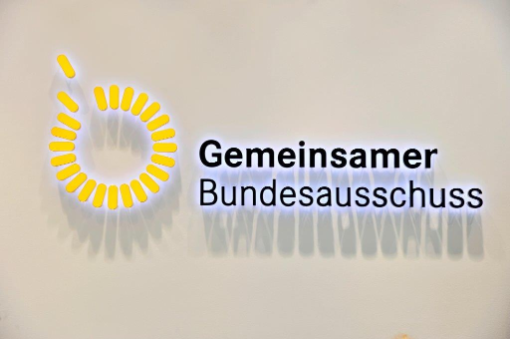

 Pflege
Pflege Selbsthilfe
Selbsthilfe Taxi- und Mietwagen
Taxi- und Mietwagen Krankenhäuser
Krankenhäuser Ärzte
Ärzte


