Das Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes (AMNOG) geht in sein fünftes Jahr. Seit seiner Einführung begleiten das Kernstück des Gesetzes, die sogenannte frühe Nutzenbewertung neuer Wirkstoffe, politische sowie wissenschaftliche Diskussionen – und auch zukünftig wird es sowohl um die großen Ziele hinter dem AMNOG als auch um die kleinen Umsetzungsdetails viel Diskussionsstoff geben.
Der Gesetzgeber selbst griff bislang in jedem Jahr seit Einführung partiell in das AMNOG-Verfahren ein und hat Teile weiterentwickelt. Gravierende Umbrüche hat es in diesem „lernenden System“ zur Wahrung der Verlässlichkeit und Stabilität der Rahmenbedingungen zunächst nicht gegeben. Zwei Eingriffe sollten jedoch weitreichende Konsequenzen haben: Das Dritte Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtlicher und anderer Vorschriften (Drittes AMG-ÄndG) Mitte 2013 brachte eine Flexibilisierung bei der Auswahl der zweckmäßigen Vergleichstherapie (zVT), die der Nutzenbewertung eines neuen Wirkstoffs zugrunde gelegt wird. Und das 14. Gesetz zur Änderung des SGB V (14. SGB V-ÄndG) Anfang 2014 beendete die Möglichkeit, bereits zugelassene Arzneimittel des Bestandsmarkts zur Nutzenbewertung aufzurufen.
Ende des Bestandsmarktaufrufs
Der Bestandsmarktaufruf war spätestens mit Vorlage der vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) geplanten Aufrufsystematik im April 2013 Gegenstand kritischer Diskussionen. Wenn es machbar gewesen wäre, den Bestandsmarkt rechtssicher und mit vertretbaren sachlichen und zeitlichen Ressourcen aufzurufen, wäre dies der Idee der frühen Nutzenbewertung folgend, patentgeschützte Präparate einer evidenz- und nutzenbasierten Preisbildung zuzuführen, zu befürworten gewesen. Es gab jedoch einige Argumente, die letztlich auch aus Sicht des Gesetzgebers für eine Beendigung sprachen. Insbesondere fehlende Rechtssicherheit und unüberschaubarer administrativer Aufwand sind hier zu nennen. Neben dem Verzicht auf erhebliche Einsparmöglichkeiten werden nun jedoch auch keine unabhängigen, detaillierten Informationen mehr zu möglicherweise unzweckmäßigen Bestandsmarktprodukten vorliegen. Zwar gibt es auch noch andere Instrumente zur Bewertung von Bestandsmarktprodukten, z. B. im Zuge von Arzneimittelrichtlinien nach § 92 in Verbindung mit 139a SGB V. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob diese geeignet sind, die aus dem Ende der Bestandsmarktbewertung resultierenden Konsequenzen zu beheben. Das zur Kompensation verlängerte Preismoratorium sowie die Fortführung eines erhöhten Zwangsrabatts dürften unter Berücksichtigung der bislang vorliegenden zusatznutzenbasierten Erstattungsbeträge die fehlenden Einsparvolumina zumindest ungefähr ausgleichen, sie im Zeitverlauf vermutlich sogar übersteigen.
Bezifferung eines Zusatznutzens
Zentrales Ergebnis der frühen Nutzenbewertung ist die quantitative Bezifferung eines Zusatznutzens sowie die Bewertung der Ergebnissicherheit der vorliegenden Evidenz. Auf Wirkstoffebene konnten, wenn das jeweils höchste Zusatznutzenergebnis aller bewerteten Subgruppen eines Wirkstoffes zugrunde gelegt wird, in 63 Prozent aller Verfahren (solche ohne vorgelegtes Dossier werden bei der Zählung nicht berücksichtigt) ein Zusatznutzen vom G-BA festgestellt werden. Dieser Wert reduziert sich, wenn Szenarien auf Subgruppen- oder Populationsebene gebildet werden. Der Gesamtanteil der positiv nutzenbewerteten Subgruppen liegt wirkstoffübergreifend bei 40 Prozent, der Anteil positiv bewerteter Patientengruppen, also die Größe der theoretischen Zielpopulation der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), mit 21 Prozent noch einmal deutlich darunter. Diese Ergebnisse aus der frühen Nutzenbewertung haben primär zwei Adressaten: Sie informieren die Erstattungsbetragsverhandlungen zwischen pharmazeutischem Unternehmer und dem GKV-Spitzenverband sowie die arzneimittelverordnende Ärzteschaft. In den Verhandlungsrunden sind unterschiedliche Zusatznutzenergebnisse in Subgruppen hinsichtlich der dahinter liegenden Populationsgröße in Relation zueinander zu setzen. Nun sorgt jedoch die subgruppenspezifische Differenzierung des Zusatznutzens innerhalb eines zugelassenen therapeutischen Anwendungsgebietes für Schwierigkeiten. Wurden vonseiten des G-BA mehrere Subgruppen mit unterschiedlichem Zusatznutzenausmaß bewertet, stellt sich die Frage, wie ein einheitlicher Erstattungsbetrag in dieser mitunter komplexen Entscheidungsmatrix adäquat abgebildet werden kann. Denn es gibt sechs verschiedene Zusatznutzenabstufungen, drei Belegabstufungen und beliebig viele Subgruppen.
Praktisch wird bei mehreren Subgruppen und damit auch Vergleichstherapien die Preisobergrenze über eine anhand der jeweiligen Populationsgrößen gewichtete Mischpreisbildung ermittelt. Unsicherheiten über die wirtschaftliche Verordnung in An- wendungsgebieten ohne Zusatznutzen sind die Folge. Zudem sind unterschiedliche Auffassungen über die Festlegung der zVT hier erneut Streitthema. Die Möglichkeit von Teil-Opt-Outs, also die Beschränkung der Zulassung auf ein Teilindikationsgebiet (mit Zusatznutzen), kam deshalb zuletzt auf die Agenda, ist jedoch hinsichtlich der praktischen Umsetzbarkeit noch zu diskutieren. Komplex ist dann die Umsetzung eines differenzierten Nutzenbewertungsergebnisses auch in der Praxis, denn es lässt sich ja nicht dichotom in „Zusatznutzen vorhanden“ und „Zusatznutzen nicht vorhanden“ einteilen. Aus der Verordnungspraxis lässt sich eine am Zusatznutzen orientierte Entwicklung bislang nicht abbilden. Basierend auf Versichertendaten der DAK-Gesundheit konnte gezeigt werden, dass der durchschnittliche Anstieg des Verordnungsvolumens von Wirkstoffen ohne Zusatznutzen innerhalb des ersten Jahres nach Veröffentlichung des G-BA-Beschlusses mit 18,5 Prozent oberhalb dem von Wirkstoffen mit geringem (17,7 Prozent) oder beträchtlichem (13,5 Prozent) Zusatznutzen liegt. Da Wirkstoffe ohne Zusatznutzen nicht von der Verordnung ausgeschlossen werden, ist es Aufgabe des Arztes, unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebotes und auf Basis der Verfahrens-Informationen über die Verschreibung innovativer Arzneimittel selbst zu entscheiden. Die Nutzenbewertung initiiert dabei keinen Automatismus. Dass letztlich auch Innovationsaspekte eine Rolle spielen können, die im methodischen Algorithmus von G-BA und Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) nicht berücksichtigt werden, zeigt die Absatzentwicklung von Fampridin (Handelsname Fampyra), welches ohne Zusatznutzen aufgrund deutlicher Verbesserungen auf Applikationsebene inzwischen zu den am meisten verordneten AMNOG-Präparaten gehört.
Mit der Dauer des Verfahrens kommt ein weiterer Sachverhalt hinzu, der die Umsetzung der Nutzenbewertung in der Praxis verkompliziert: Patentgeschützte Originale, welche selbst die frühe Nutzenbewertung durchlaufen haben, werden selbst zur Vergleichstherapie. Damit gibt es in einer vergleichenden Bewertung von AMNOG-Präparaten insbesondere aus demselben Anwendungsgebiet unterschiedliche Nenner. Ein fehlender Zusatznutzen ist deshalb nicht pauschal, sondern immer in Abhängigkeit vom Komparator zu interpretieren. Einige neue Wirkstoffe kommen gar nicht erst in die Versorgung. Opt-Outs sind inzwischen fester Bestandteil des Verfahrens. Der Anteil der vom Markt genommen Wirkstoffe liegt Ende 2014 bei 19 Prozent. Die Gründe für eine Marktrücknahme sind vielfältig und die Konsequenzen für die GKV-Versorgung bislang nur schwer abzuschätzen. Auffällig ist der hohe Anteil an Marktrücknahmen nach einem Schiedsspruch. Abhängig vom Zeitpunkt haben Marktrücknahmen eine hohe Versorgungsrelevanz, da entsprechend behandelte Patienten auf alternative Präparate umgestellt werden müssen. Für das orale Antidiabetikum Vildagliptin konnte inzwischen gezeigt werden, dass innerhalb des ersten Quartals nach Opt-Out 71 Prozent der zuvor behandelten Patienten auf eine Alternativtherapie umgestellt waren. Die Überraschung: Die Umstellung fand überwiegend in dieselbe Wirkstoffklasse statt. Kaum umgesteuert wurde auf die zuvor vom G-BA festgelegte Vergleichstherapie. Eine einfache Hochrechnung möglicher Einspareffekte anhand der vom G-BA festgelegten Vergleichstherapie hätte in diesem Falle also nicht der Versorgungsrealität entsprochen, sondern hätte zu beträchtlichen Überschätzungen potenzieller Einsparungen geführt.
Das AMNOG wirkt als Methodenkatalysator
Abseits der inhaltlichen Ergebnisdiskussion hat sich das AMNOG vor allem zu einem Methodenkatalysator entwickelt. Die öffentlichen Stellungnahmen und Diskussionen mit Experten und medizinischen Fachgesellschaften können in dieser Form als großer Gewinn der frühen Nutzenbewertung betrachtet werden. Der Titel des 2013er Herbstsymposiums des IQWiG „Lebensqualität – Wissen wir, was wir tun?“ leistete beispielsweise einen großen Beitrag zu einem konstruktiven Dialog um den Stellenwert von Lebensqualitätsdaten im Frühbewertungsverfahren. Erfreulich ist dabei zunächst, dass anders als noch in Prä-AMNOG-Zeiten in den heutigen Nutzendossiers deutlich mehr Daten zur Lebensqualität berichtet werden. In vier von fünf Dossiers wurden bislang entsprechende Daten vorgelegt. Der Hersteller selbst leitete aus knapp der Hälfte einen Zusatznutzen ab. Bis Anfang 2015 genügten diese jedoch nur in drei Fällen dem Anspruch des G-BA. Dies liegt zwar auch darin begründet, dass viele Daten aufgrund abweichender Vergleichstherapien oder anderer obligater Ausschlussgründe erst gar nicht ausgewertet wurden. Dennoch muss zukünftig überlegt werden, ob ein pauschaler Ausschluss von Lebensqualitätsergebnissen infolge z. B. zu geringer Responsequoten dem Anspruch von „best available evidence“ genügt oder ob mit den (typischen) Auswertungsproblemen patientenberichteter Endpunkte nicht auch anders verfahren werden kann. Der Ansatz des IQWiGs, in der Bewertung des Wirkstoffs Radium-223-dichlorid fehlende Werte mit geeigneten statistischen Verfahren abzuschätzen (sogenannte Imputationsverfahren) und so trotz nicht ganz vollständiger Werte eine Analyse zu ermöglichen, ist im Sinne des eingangs erwähnten „lernenden Systems“ deshalb zu begrüßen.
Entwicklungsperspektiven des AMNOG
Spätestens seit der medienwirksamen Diskussion um das Hepatitis-Medikament Sovaldi (Wirkstoff Sofosbuvir) steht der Zeitraum temporär freier Preisbildung des Herstellers auf der politischen Agenda. Denn der Nutzenbewertungsrabatt nach § 130b SGB V gilt erst ab dem 13. Monat. Die Höhe des potenziellen zusätzlichen Einsparvolumens eines vollständig rückwirkenden § 130b-Rabattes ergibt sich aus den Umsatzvolumina. Innerhalb der ersten zwölf Monate sind in der Regel nur langsam ansteigende Absatzentwicklungen zu beobachten. Einzig die neu eingeführten Hepatitis C-Präparate Boceprevir, Telaprevir sowie Sofosbuvir zeigten atypische Verläufe, indem ein Großteil des Umsatzes bereits vor Greifen des Nutzenbewertungsrabattes innerhalb der ersten Verkehrsmonate realisiert wurde. Dies ist auf Rückstellungseffekte in der Therapie sowie auf die erstmalige Verfügbarkeit interferonfreier und damit nebenwirkungsärmerer Therapieformen zurückzuführen. Von einem strukturellen Negativeffekt der (zeitlich begrenzten) freien Preisbildung kann bislang nicht ausgegangen werden. Dennoch ist aufgrund der Tragweite und der direkten Steuerungswirkung davon auszugehen, dass die temporär freie Preisbildung auf der politischen Agenda bleibt. Eine weitere Frage ist, ob die Einbeziehung von Kosten-Nutzen-Analysen für die Preisverhandlungen Vorteile brächte. Im AMNOG-Verfahren werden nur die rechnerisch denkbaren Mehrkosten für die Krankenkassen durch das neue Arzneimittel einbezogen. Vermiedene Kosten in anderen Leistungsbereichen oder langfristige Kosten-Nutzen-Effekte z. B. durch Einsparungen von Folgekosten finden keine Berücksichtigung. Kosten-Nutzen-Analysen, die solche Informationen liefern könnten, sind jedoch derzeit faktisch irrelevant, da sie erst nach gescheitertem Schiedsverfahren und nur auf Antrag durchgeführt werden sollen. Kosten-Nutzen-Analysen könnten also erst 15 Monate nach Markteinführung beginnen und würden dann beim IQWiG geschätzt mindestens ein Jahr in Anspruch nehmen. Darum ist der Anreiz einer Verhandlungslösung vor der Kosten-Nutzen-Bewertung hoch. Wohlfahrtsmaximal ist die Lösung jedoch aller Voraussicht nach nicht. Auch er Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (SVR-Gesundheit) regte zuletzt noch einmal an, im Rahmen der Preisverhandlungen Kosten-Nutzen-Analysen mit einbringen zu können. Einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen zufolge sind aber hinsichtlich des Stellenwertes von Kosten-Nutzen-Analysen zeitnah keine Veränderungen zu erwarten. Positiv hervorzuheben ist, dass die frühe Nutzenbewertung eine eigene Feedback-Schleife entwickelt hat: Dem Problem, einen fehlenden Zusatznutzen infolge fehlender Evidenz aussprechen zu müssen, begegnet der G-BA inzwischen vielfach mit zeitlich limitierten Beschlüssen. Jedes vierte Verfahren ist mittlerweile befristet. Hersteller haben dann im Schnitt drei Jahre Zeit, weiteres Evidenzmaterial vorzulegen. Zur Weiterentwicklung der Nutzenbewertung und Stärkung der Versorgungsforschung in Deutschland wäre zu überlegen, ob diese „Kann-Option“ zukünftig nicht in eine verpflichtende Re-Evaluation umgewandelt wird.




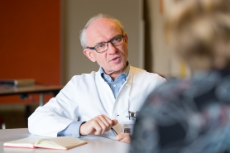





 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026
Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026
Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


