
In Deutschland gibt es derzeit rund 1.500 Akutkrankenhäuser und 500 Spezialkliniken, um die stationäre Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Die Verantwortung für die Krankenhausplanung liegt bei den Bundesländern. Ist die derzeitige Krankenhausplanung noch zeitgemäß? Der Gesundheitsökonom Prof. Dr. Thomas Mansky gilt als anerkannter Kritiker der Krankenhauslandschaft. Im Interview mit ersatzkasse magazin. stellt er die Krankenhausstrukturen auf den Prüfstand.
Top-Hochleistungsmedizin auf der einen Seite, Qualitätsmängel auf der anderen. Wo verorten Sie die Krankenhausversorgung in Deutschland?
Thomas Mansky Deutschland hat überwiegend eine sehr gute medizinische Versorgung, die allerdings bei unterschiedlich guter medizinischer Qualität im Mittel hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibt. Hervorzuheben ist der allgemeine Zugang zu medizinischen Leistungen mit sehr geringen Zuzahlungen bei freier Wahl des Leistungserbringers. Die Investitionsschwäche und erhebliche, sich aufstauende strukturelle Probleme führen allerdings dazu, dass Deutschland im internationalen Vergleich zunehmend zurückfällt.
1.500 Akutkrankenhäuser, 500 Spezialkliniken. Brauchen wir so viele Kliniken?
Es geht nicht primär um die Frage der Schließung von Krankenhäusern. Es geht um notwendige Strukturveränderungen, um den Anforderungen der modernen Medizin gerecht zu werden und damit verbunden um die Verbesserung der medizinischen Qualität. Die derzeitige Krankenhauslandschaft wird nicht in der Lage sein, die medizinische Versorgung so zu erbringen, wie es nach den aktuellen medizinischen Standards nötig wäre. Alle reden vom medizinischen Fortschritt, aber tun so, als ob die Strukturen davon nicht betroffen wären. Wir machen die Medizin des 21. Jahrhunderts in den Strukturen des späten 20. Jahrhunderts. Viele Klinikstandorte wurden im 19. Jahrhundert geplant, zu ganz anderen Zwecken, etwa wegen Cholera-Epidemien. Natürlich haben sich die Krankenhäuser verändert, aber die historisch gewachsenen Versorgungsstrukturen sind heute nicht mehr adäquat, um eine zukunftsfähige Medizin zu erbringen. Daher brauchen wir einen Strukturwandel.
Was sind die Kernprobleme?
Ich sehe vier große Probleme, die die medizinische Versorgungsqualität beeinträchtigen: die apparative Ausstattung der Krankenhäuser, die personelle Ausstattung, der demografische Wandel und die nicht ausreichende Investitionsfinanzierung durch die Bundesländer.
Wo liegt das Problem bei der apparativen Ausstattung?
Die Möglichkeiten zur apparativen Ausstattung hängen mit der Betriebsgröße zusammen. Als die Krankenhäuser entstanden sind, gab es kein MRT, CT oder andere sehr teure Geräte, die ein Patient heute zu Recht erwartet. Diese in der Anschaffung und im Betrieb kostenintensiven Geräte können aber nur medizinisch und wirtschaftlich sinnvoll betrieben werden, wenn das Krankenhaus sie mit hinreichenden Fallzahlen auslasten kann. Ein Linksherzkatheterplatz müsste für die Notfallversorgung in einem 24-Stunden-Turnus betrieben werden. Ein Viertel der Krankenhäuser, die in Deutschland Herzinfarkte behandeln, behandelt aber weniger als 28 im Jahr, die Hälfte weniger als 72. Solche Kliniken können eine 24-Stunden-Versorgung kaum zu wirtschaftlich sinnvollen Bedingungen vorhalten. Das Auslastungsproblem im elektiven Einsatz umschiffen sie oft, indem sie solche Geräte gemeinsam mit niedergelassenen Ärzten betreiben, sodass sich die Anschaffung durch ambulante Mitnutzung amortisieren kann. Das ist richtig, aber nur begrenzt möglich. Ferner besteht die Gefahr großzügiger Indikationsstellungen im elektiven Bereich, was die Versorgungsqualität mindert.
Wie sieht es mit der personellen Ausstattung aus?
Die personelle Ausstattung hängt mit der Spezialisierung in der Medizin zusammen. Im ärztlichen Bereich fand in den letzten Jahren eine sehr starke Spezialisierung statt. Früher gab es den Allgemeinchirurgen, der in einem kleinen Grundversorgungskrankenhaus die reguläre Bauchchirurgie betreiben, aber auch einen Unfall behandeln konnte. Heute müssen Sie dafür zwei Ärzte unterschiedlicher Fachrichtungen einstellen, einen Viszeralchirurgen und einen Unfallchirurgen. Ähnlich sieht es in der Inneren Medizin mit der Gastroenterologie und Kardiologie aus. Die kleinen Grundversorgungskrankenhäuser stützen sich ja vor allem auf diese zwei Bereiche, Chirurgie und Innere Medizin. Natürlich gibt es den Allgemeinchirurgen und den Allgemeininternisten noch, aber man könnte fast sagen, sie sind eine aussterbende Gattung, und in Zukunft wird es sehr schwierig, diese Stellen zu besetzen.
Der demografische Wandel als drittes Problem wirkt sich vor allem im Pflegebereich aus.
Der demografische Wandel führt heute schon zu einem erheblichen Fachkräftemangel in der Pflege, obwohl wir erst am Anfang des demografisch bedingten Personaldefizits stehen. Der Bundesgesundheitsminister hat mit dem 2019 in Kraft getretenen Pflegepersonal-Stärkungsgesetz das Pflegebudget aus dem DRG-Fallpauschalensystem ausgegliedert, um die Personalausstattung zu verbessern. Aber das ist derzeit für die Krankenhäuser ein Blankoscheck, den sie kaum einlösen können. Denn sie finden auf dem Markt keine Pflegekräfte. Damit nicht genug, dieser sogenannte Pflexit verursacht Nebenwirkungen: Die Krankenhäuser werben Pflegekräfte aus Altenheimen und Reha-Einrichtungen mit Prämien ab. Erste Pflegeheime müssen bereits schließen, weil sie nicht mehr genügend Pflegekräfte haben, um ihr Altenheim betreiben zu können. Als zweite Nebenwirkung setzen die Krankenhäuser neu gewonnene Pflegekräfte tendenziell wieder für bereits substituierte Aufgaben ein, beispielsweise krankenhausinterne Transporte oder Stationsassistenzen. Bereiche, in denen keine originär pflegerische Tätigkeit gefordert ist, übernimmt derzeit oft weniger qualifiziertes Personal, ein Trend, der richtig ist und angesichts des Mangels an Pflegekräften ausgebaut werden müsste, was aber durch das neue Gesetz konterkariert wird. Inwieweit die Anwerbung von Pflegekräften im Ausland eine Entlastung bringen wird, bleibt abzuwarten. Im Übrigen sei erwähnt, dass das neue Gesetz mit der Kostenerstattungsphilosophie die bestehenden, reformbedürftigen Strukturen eher zementiert – das Gegenteil von dem, was wir bräuchten.
Was bewirkt die mangelnde Investitionsfinanzierung der Länder?
Die Länder sind für die Investitionen, also unter anderem für die bauliche und apparative Ausstattung der Kliniken, zuständig. Die Krankenkassen sollen dagegen in der dualen Finanzierung nur die Betriebskosten finanzieren, die bei der Behandlung von Patienten entstehen. Die Investitionsquote der Länder betrug 2016 im Mittel 3,9 Prozent bei den Plankrankenhäusern, was zum Überleben nicht reicht. Diese Kennzahl, also der Anteil der Investitionen im Verhältnis zum Umsatz, muss – je nach Versorgungsstufe und Leistungsstruktur des Krankenhauses – bei acht bis 15 Prozent liegen. Andernfalls verfallen die Kliniken mittelfristig und sie können ihren Gerätepark nicht modernisieren. Derzeit wird ein Großteil der Investitionen von den Krankenhäusern, die es können, über Gewinne aus dem operativen Geschäft finanziert. Was bedeutet, dass diese Investitionen mittelbar von den Krankenkassen finanziert werden. Dies wird von der Politik einerseits mit einem Augenzwinkern hingenommen, andererseits wird dann oft das „Gewinnstreben“ der Krankenhäuser verteufelt – mehr Bigotterie geht kaum. Allerdings wäre mehr Geld allein natürlich nicht die Lösung für die Probleme in der Krankenhauslandschaft.
Nicht mehr nur Geld allein, aber was stattdessen?
Wir müssen die Krankenhausplanung bundesweit vom Kopf auf die Füße stellen. Wir brauchen keine Fortschreibung der bestehenden Strukturen, sondern ein Neudenken. In der momentanen Krankenhausplanung gelten die Strukturen als gesetzt. Entsprechend funktioniert die Planung überwiegend nach dem Rasenmähermodell: Es wird überall versucht, ein bisschen zu streichen. Gelegentlich wird umgewidmet, manchmal werden Abteilungen oder kleine Krankenhäuser geschlossen, aber nicht konsequent. Das reicht nicht. Genauso falsch ist der Ansatz, auf Teufel komm raus Krankenhäuser schließen zu wollen. Im Fokus müssen zukunftsfähige Versorgungsstrukturen stehen, die in der Lage sind, die Medizin nach heutigem und künftigem Stand anzubieten.
Wie lässt sich das umsetzen?
Wir brauchen leistungsfähige, gut ausgestattete zentralisierte Standorte und zusätzlich dort, wo es nötig ist, also im ländlichen Bereich, komplementär kleinere Grundversorger mit spezifiziertem Aufgabenzuschnitt in der Fläche und mit strukturierten Verlegungswegen in die zentralisierten Kliniken. Dabei müssen die Zentren gestärkt und ausgebaut werden, damit sie Versorgungsaufgaben der bisherigen kleinen Häuser übernehmen können. Natürlich kommt auch die Anzahl der Kliniken auf den Prüfstand, Schließungen werden sich als Folge daraus ergeben. Aber es muss deutlich werden, dass wir beide Seiten der Medaille brauchen: einen Abbau der nicht zukunftsfähigen Krankenhäuser und eine Stärkung der Zentren.
Woran machen Sie nicht zukunftsfähige Krankenhäuser fest?
Das sind vor allem nicht spezialisierte Krankenhäuser mit unter 300 Betten, die nicht die technischen Geräte und das entsprechend spezialisierte Personal vorhalten können. 2016 hatten wir dem Statistischen Bundesamt zufolge in Deutschland 1.064 Allgemeinkrankenhäuser mit weniger als 300 Betten. Von diesen überwiegend nicht spezialisierten Kliniken liegt etwa die Hälfte in städtischen Bereichen. Sind diese Kliniken versorgungsnotwendig? Um es mit Blick auf den Fachkräftemangel mal so zu sagen: Wir suchen Personal, das wir nicht haben, für Krankenhäuser, die wir zum Teil nicht brauchen. In den Städten kann ich natürlich rasch etwas ändern, weil sich hier die Frage nach der Erreichbarkeit nicht stellt. Bei der anderen Hälfte, also den ländlichen Versorgern, ist genau zu überlegen, wie man vorgeht und dort die Versorgung strukturiert. Das Krankenhaus auf Helgoland zum Beispiel hat auch eine kritische Größe, aber auf das wird man ganz sicher nicht verzichten wollen. Aber folgt daraus logisch, dass wir derartige Krankenhäuser in Berlin oder dem Ruhrgebiet brauchen? Dass in Deutschland 602 Krankenhäuser um 11.397 weit überwiegend planbare Bauchspeicheldrüsenoperationen konkurrieren, 38 Prozent davon unter der Mindestmenge, muss aufhören.* Und warum werden in städtischen Bereichen Patienten mit Herzinfarkt in Kliniken ohne Linksherzkatheter behandelt, obwohl die nächste Klinik mit Linksherzkatheter um die Ecke liegt? In ihrem Bemühen zu überleben, expandieren kleinere Kliniken in Bereiche, für die sie nicht adäquat ausgestattet sind. Und dies, obwohl bei vielen komplexeren Krankheitsbildern die Qualität bei kleinen Fallzahlen im Mittel messbar schlechter ist. Dies sind Folgen des Überangebots an stationären Kapazitäten. Solche Strukturen führen zu einem Doppeleffekt: Einerseits werden Patienten in Kliniken behandelt, die für diese Behandlung nicht entsprechend ausgerüstet sind. Andererseits werden Zentren, die die benötigten Strukturen vorhalten, geschwächt, weil sie die Fälle, für deren Behandlung sie eingerichtet sind, nicht bekommen.
Welche Rolle spielt die Erreichbarkeit?
Es scheint zwar so, als ob Erreichbarkeit ein großer Faktor wäre, gerade wenn wir an die Menschen denken, die gegen Krankenhausschließungen protestieren. Aber wenn diese Menschen zu Patienten werden, fragen sie nicht danach, wo das nächste Krankenhaus ist, sondern wo sie die beste Behandlung erhalten. Umfragen zufolge sind sie für eine qualitativ gute Behandlung durchaus bereit, 100 Kilometer Anfahrt in Kauf zu nehmen. Je schwerer das Krankheitsbild, umso größer die Bereitschaft, weit zu fahren. Es nützt dem Patienten nichts, wenn er in das Krankenhaus um die Ecke kommt, aber dann nicht so versorgt wird, wie es heute eigentlich Standard ist. Die Qualität der Versorgung hat also Priorität.
Es gibt einige Versuche, die Krankenhausplanung stärker nach Qualität auszurichten.
Natürlich muss Qualität eine wesentliche Rolle spielen, aber nur nach Qualität zu planen, löst die Strukturprobleme nicht. Wir versuchen seit 30 Jahren auf Umwegen, etwa über Qualitätsmerkmale oder das Vergütungssystem, eine Strukturbereinigung zu erreichen. Gezeigt hat sich, dass keiner der Umwege zum Ziel führt. Wir reden von planungsrelevanten Qualitätsindikatoren, die derzeit einen minimalen Bereich der Medizin betrachten, hauptsächlich Gynäkologie und Geburtshilfe. Unbestritten brauchen wir Qualitätsindikatoren, genauso wie eine Qualitätsmessung, um im laufenden Betrieb die Qualität zu sichern. Und solange nicht an den Grundfesten des Systems gerüttelt wird, sind sie ein toller Ansatz. Aber wenn Sie sich das Strukturproblem vor Augen führen, sind es nur Mückenstiche in diesem Konglomerat.
Wie verhält es sich mit den Mindestmengen?
Die Mindestmengen, die es etwa für Knie-Operationen oder Lebertransplantationen schon gibt, sind ein bisschen mehr als Mückenstiche. Vorausgesetzt sie werden auch umgesetzt, sind sie unter den gegebenen Bedingungen wichtig, um wenigstens die allerschlimmsten Auswüchse der heutigen Strukturen unter Kontrolle zu halten. Wenn beispielsweise ein Krankenhaus drei bis fünf Bauchspeicheldrüsenoperationen im Jahr durchführt, ist das schlicht absurd. In solchen Fällen sind Mindestmengen nötig. Aber auch sie lösen nicht die Strukturkrise, in der wir uns befinden.
Gibt es Vorbildländer für eine Strukturreform?
Dänemark hat eine echte Strukturreform mit gezieltem Strukturaufbau durchgeführt, und das mit großem Erfolg, auch wenn hier und da Nachbesserungen nötig sein sollten. Es war eine klare politische Entscheidung. Dabei hat man der Bevölkerung klargemacht, dass für eine zukunftsfähige Medizin Reformen notwendig sind. Dänemark hat Krankenhäuser zusammengelegt und zentralisiert, wobei auch Standorte geschlossen und Betten abgebaut wurden. Aber etwas Neues ist entstanden. Dafür hat Dänemark eine erhebliche Menge an Geld in die Hand genommen. Umgerechnet auf die Bevölkerung Deutschlands investierte es über 70 Milliarden Euro. Aber es verteilte dieses Geld eben nicht mit der Gießkanne.
Ist die Politik mutig und bereit für so eine klare Strukturreform
Wir müssen der Wahrheit ins Auge sehen: Wir brauchen viel weniger Krankenhäuser und dies ist kein Sozialabbau, sondern bedeutet qualitativ eine Stärkung der medizinischen Versorgung. Im Moment sehe ich aber wenig Chancen, dass die notwendige Strukturreform politisch durchsetzbar ist. Die Politik hält mit Mühe ihre Koalitionen zusammen, die Wahlergebnisse kippen. Da bringt keine Partei den Mumm auf, ein kritisches Thema anzupacken. Zumal die Bundesebene den Ländern auch nicht einfach so die Verantwortung im Krankenhausbereich entziehen kann. Da muss noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Das Thema muss auch in der Öffentlichkeit richtig verstanden werden. Dazu können Institutionen wie die Krankenkassen beitragen. Denn eine Reform wird eher kommen, wenn der Druck auf das Bundesgesundheitsministerium so groß ist, dass die Politik gezwungen ist zu reagieren. Hinter vorgehaltener Hand ist auch die Rede davon, dass der Fachkräftemangel indirekt die Strukturreform erzwingen wird. Und es ist auch eine Frage der Betrachtung: Eine Strukturreform ist eine undankbare Aufgabe, solange man nur die Schließung von Krankenhäusern vor Augen hat. Aber es ist eine dankbare Aufgabe, wenn ein 70-Milliarden-Euro-Programm aufgelegt wird, um die Krankenhäuser gezielt zu modernisieren und eine zukunftsfähige Medizin sicherzustellen.
*Zahlen von 2016








.jpg.thumb.700.230.png)


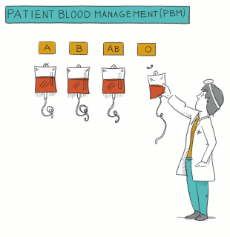


 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2024
Landesbasisfallwerte 2024 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2024
Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2024 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


