
Die große Koalition nimmt sich die Pflege vor: Zum Jahreswechsel tritt das Pflegestärkungsgesetz I in Kraft, genauso das Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. Spätestens 2017 soll das Pflegestärkungsgesetz II mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff kommen. Endlich eine Pflegereform, wie sie schon lange erwartet wurde? Prof. Dr. Heinz Rothgang von der Universität Bremen ist sowohl Mitglied im Expertenbeirat zur Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs als auch Leiter einer aktuellen Studie, die Teil der Erprobungsphase des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs ist. Im Gespräch mit ersatzkasse magazin. wirft der erfahrene Gesundheitsökonom einen Blick auf die Vorhaben in der Pflege.
Herr Prof. Dr. Rothgang, das Pflegestärkungsgesetz I wird 2015 in Kraft treten. Es bringt Leistungsverbesserungen, Leistungsdynamisierung und einen Vorsorgefonds. Fangen wir mit den Leistungsverbesserungen an: eine gute Sache?
Prof. Dr. Heinz Rothgang Die Leistungsverbesserungen, wie zum Beispiel die Flexibilisierungen und Leistungsausweitungen in der Tages- und Nachtpflege sowie der Verhinderungs- und Kurzzeitpflege, weitere Leistungen zur Förderung anderer Wohnformen oder die Erhöhung des Stellenschlüssels für Betreuungskräfte in Heimen, sind eigentlich alle in Ordnung. Insofern würde ich da einen Haken dran machen.
Wie sieht es mit der Leistungsdynamisierung – also Anpassung der Leistungsbeträge – um in der Regel vier Prozent aus?
Da würde ich ein Fragezeichen dran machen. Warum? Die Leistungsdynamisierung reicht gerade knapp für einen Inflationsausgleich, leistet aber keinen Beitrag dazu, den Wertverlust der Pflegeversicherung in den Jahren 1995 bis 2008 auszugleichen. Der reale Wert der Pflegeversicherungsleistungen ist daher heute um 20 bis 25 Prozent niedriger als bei ihrer Einführung. Das größte Problem aber ist, dass auch für die Zukunft keine feste Regelbindung besteht. Es heißt, in drei Jahren wird „geprüft“. Das finde ich zu wenig.
Was konkret hätten Sie sich gewünscht?
Eine regelgebundene Anpassung. So wie man es aus der Rentenversicherung kennt. Dort wird am 1. Juli jeden Jahres geschaut, wie sich Löhne und Gehälter entwickelt haben im Vergleich zum vorvergangenen Jahr, entsprechend wird der aktuelle Rentenwert angepasst. So etwas bräuchten wir in der Pflege auch, um zu verhindern, dass die Leistungen an Wert verlieren. Dass wir bis 2008 im Wesentlichen mit einem konstanten Beitragssatz von 1,7 Prozent operiert haben, war nur möglich, weil der Wert der Pflegeversicherungsleistungen kontinuierlich gesunken ist. Die jetzt beschlossene Dynamisierung ist deshalb mehr als nichts, aber auch nicht so, wie ich es gerne hätte. Wir sind auch hier noch lange nicht am Ziel. Das Ziel wäre eine regelgebundene Leistungsdynamisierung, die Kaufkraftstabilität sichert.
Dritter Punkt: Pflege-Vorsorgefonds.
Das ist der größte anzunehmende Unsinn. Der Gedanke des Pflege-Vorsorgefonds ist der: Ab 2015 werden zusätzliche 0,1 Beitragssatzpunkte erhoben und die so generierten Ein-nahmen werden über 20 Jahre zurückgelegt. Ab 2035 fließt das Geld wieder ins System, pro Jahr maximal ein Zwanzigstel der bis 2034 aufgelaufenen Summe. Da das Kapital auch während der Auszahlungsphase weiter verzinst wird, hält es etwas länger als 20 Jahre. Das ist die Idee. Doch ich glaube nicht daran, dass 2034 noch etwas in dem Fonds ist. Das ist das erste Problem. In der Geschichte finden sich keine Beispiele dafür, dass eine Regierung so eine Rücklage bildet und dann wirklich 20 Jahre in Ruhe lässt. Denn es kommt immer die nächste aktuelle Krise, und die ist immer wichtiger. Das kann man auch keinem Finanzminister vorwerfen. Stellen Sie sich vor, die nächste Wirtschafts- oder Finanzkrise kommt, und die Regierung will intervenieren. Wieso sollte sie sich dann verschulden, wenn doch Geld im Fonds ist?
Und das zweite Problem?
20 Jahre wird angespart, gut 20 Jahre wird entspart, danach ist der Fonds leer; also etwa im Jahr 2055 bis 2060, genau dann, wenn laut Prognosen die Zahl der Pflegebedürftigen am höchsten ist. So hat man für die Kohorten, die dann kommen, nichts getan. Wir belasten die Beitragszahler der Jahre 2015 bis 2034, wir entlasten die Beitragszahler der Jahre 2035 bis 2055, und wir machen nichts für die Beitragszahler danach. Mit „Generationengerechtigkeit“, die in diesem Kontext immer wieder genannt wird, hat das nichts zu tun. Argumentiert wird, dass dann, wenn der Fonds leer ist, wieder alles leichter wird, weil die Zahl der Pflegebedürftigen zurückgeht. Das ist aber grundsätzlich fehlkonzipiert. Denn auch die Zahl der Beitragszahler geht zurück, und in einem umlagefinanzierten System hängt der Beitragssatz ab von dem Verhältnis der Zahl der Leistungsempfänger und der Beitragszahler. Auch nach 2055 bleibt der Beitragssatz also hoch und der Fonds kann keine „Belastungsspitze“ abfedern, weil es eine solche Spitze nicht gibt. Es gibt keinen Belastungsberg, der untertunnelt werden kann, sondern den Aufstieg auf ein Hochplateau.
Wie hoch würde der Beitrag steigen ohne den Vorsorge-Fonds?
Ich denke, bei stabiler Pflegeversicherungsleistung, solidem Wirtschaftswachstum und der uns bekannten demografischen Entwicklung würde der Beitragssatz auf vielleicht vier Beitragssatzpunkte ansteigen, und dort bleibt er dann. Was nicht wenig ist, aber in einer Gesellschaft des langen Lebens wahrscheinlich angebracht. Fakt ist: Die meisten von uns haben am Ende des Lebens eine Phase der Pflegebedürftigkeit und diese muss finanziert werden. Die einzige Frage ist, ob die dabei anfallenden Ausgaben solidarisch finanziert werden oder nicht. Der Pflegevorsorgefonds reduziert den Beitragssatz dann um rund 0,1 Beitragssatzpunkte und ist damit von der Höhe der Entlastung her irrelevant.
Was halten Sie von dem Pflege-Bahr?
Auch nichts. Ich halte Kapitaldeckung grundsätzlich für eine Illusion, denn sie tut so, als könnte man Lasten verschwinden lassen. Man kann aber bestenfalls Lasten in der Zeit umverteilen. Im Moment nutzen etwa 400.000 Personen den Pflege-Bahr, also ein Prozent der Erwerbsbevölkerung bzw. ein halbes Prozent der Bevölkerung in Deutschland. Im Gesetzentwurf waren dagegen 1,5 Millionen Personen bereits für 2013 vorgesehen. Der Pflege-Bahr ist damit ein Nischenprodukt und wird es auch bleiben. Und wer nimmt das in Anspruch? Besserverdienende. Wer finanziert das? Alle. D. h., wir haben eine Umverteilung von unten nach oben. Der Sozialstaat steht auf dem Kopf. Außerdem: Niemand kann vorhersagen, wie hoch die Pflegekosten in 50 Jahren sind, wie hoch die Leistungen der sozialen Pflegeversicherung sind und wie groß die Lücke ist, die es durch die Zusatzversicherung zu schließen gilt. Genau das müssten Sie aber wissen, wenn Sie als 30-Jähriger einen Pflege-Bahr-Vertrag abschließen. Das ist nicht möglich und Kapitaldeckung ist in der Pflege daher grundsätzlich Unsinn.
Wir haben jetzt zwei Systeme von Kapitaldeckung, den Fonds und den Pflege-Bahr.
Ja, und beide sind ungeeignet: Der Pflege-Bahr ist noch individualisiert, kommt nur für eine Minderheit infrage, nämlich Besserverdienende, und hat sozialpolitisch problematische Umverteilungseffekte. Der neue Vorsorgefonds ist immerhin innerhalb des solidarischen Systems, aber funktionieren wird er auch nicht. Ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei, die Last dann zu stemmen, wenn sie anfällt. Denn nur dann sehen wir auch, wie hoch sie wirklich ist und was gebraucht wird. Natürlich wird im Jahr 2050 die Belastung höher sein. Aber diese Last könnte zum Beispiel dadurch gedämpft werden, dass man die Privatversicherten einbezieht.
Wie das?
In einer Bürgerversicherung wären die bisher Privat- und Sozialversicherten zusammen. Die Privatversicherten sind jünger, gesünder und einkommensstärker: Wenn man das sozialversicherungspflichtige Einkommen nimmt, haben sie ein um 60 Prozent höheres Einkommen. Auch die Altersstruktur ist ganz anders: Stark besetzt sind bei den Privatversicherten die heute 35- bis 65-Jährigen, also die Beschäftigten; schwach besetzt sind die Jahrgänge der heute 65-Jährigen und Älteren, also die Rentner, bei denen auch in erhöhtem Umfang Kosten entstehen. Mit dem Nebeneinander von privater und sozialer Pflegeversicherung haben wir so ein System geschaffen, in dem es zwar Solidarität innerhalb der jeweiligen Versicherung gibt, aber nicht zwischen den Systemen, also zwischen den guten Risiken in der Privatversicherung und den schlechten in der Sozialversicherung. Das finde ich schwer zu rechtfertigen. Und verfassungsrechtlich halte ich die Einbeziehung der bislang Privatversicherten in die soziale Pflegeversicherung für viel leichter als in der Krankenversicherung.
Wie würde sich das finanziell auf die soziale Pflegeversicherung auswirken?
Allein die Einbeziehung der Privatversicherten würde den Beitragssatz zur Pflegeversicherung um 0,3 Beitragssatzpunkte senken – also der dreifache Effekt des Pflegevorsorgefonds. Im Zeitverlauf würde dieser Effekt dadurch gedämpft, dass die Mitgliedschaft der privaten Pflegeversicherung schneller altert als die der Sozialversicherung. Gerade hierfür werden in der Privatversicherung aber Altersrückstellungen gebildet, die sich inzwischen bereits auf 25 Milliarden Euro belaufen. Die Frage ist, wem gehören diese Rücklagen? Sie gehören nicht dem Versicherten, denn er kann sie nicht mitnehmen, wenn er die Privatversicherung wechselt. Aber es sind Beiträge der Versicherten, daher können sie eigentlich auch nicht dem Versicherungsunternehmen gehören. Normalerweise wird argumentiert, sie gehören dem Versichertenkollektiv. Wenn das gesamte Versichertenkollektiv in die Sozialversicherung wechselt, müssten daher auch die Altersrückstellungen mitgenommen werden. Über die damit verbundenen verfassungsrechtlichen Fragen müsste letztlich aber das Verfassungsgericht urteilen.
Sehen Sie andere Möglichkeiten der Einbeziehung der privaten Pflegeversicherung?
Das wäre die Einführung einer Art Risikostrukturausgleich zwischen privater und sozialer Pflegeversicherung. Das ist übrigens ein System, das auch für die Krankenversicherung funktionieren würde. Die privat Versicherten könnten entsprechend ihres Einkommens in den Gesundheitsfonds einzahlen. Dann erhalten sie Zuweisungen entsprechend des Morbi-RSA, und diesen Voucher können sie dann bei ihrer privaten Versicherung einlösen. So könnte man es in der Krankenversicherung und in der Pflegeversicherung machen. In der Pflegeversicherung würde der Ausgleichsfonds dann die Rolle des Gesundheitsfonds einnehmen. Insgesamt ist ein Finanzausgleich in der Pflegeversicherung sogar noch einfacher, weil die Leistungen in Sozial- und Privatversicherung gleich hoch sind.
Sehen Sie Chancen, dass die Politik in diese Richtung denkt?
Schon im Koalitionsvertrag 2005 zwischen Schwarz und Rot war neben einem Element der Kapitaldeckung auch ein Finanzausgleich zwischen sozialer und privater Pflegeversicherung vorgesehen. Die große Koalition hat sich also schon einmal darauf verständigt. Es ist also theoretisch nicht ausgeschlossen. Aber das passiert sicher nicht mehr in dieser Legislaturperiode, vielleicht in der nächsten.
Kommen wir zum Pflegebedürftigkeitsbegriff. Glauben Sie, er kommt 2017?
Schon als 1994 der derzeit gültige Pflegebedürftigkeitsbegriff festgelegt wurde, gab es Befürchtungen, er sei zu eng gehalten. Es stellte sich heraus, dass vor allem Menschen mit Demenz nicht ausreichend berücksichtigt sind. Das greift der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff jetzt auf, und ja, ich habe den Eindruck, 2017 kommt er wirklich. Der Zeitpunkt ist gekommen, das wissen auch alle Akteure. Allerdings sind die Vorbereitungen noch nicht so weit gediehen, dass man ihn jetzt sofort einführen kann.
Woran hakt es?
In erster Linie an der Hinterlegung mit Geldbeträgen. Das neue Begutachtungsassessment sieht fünf Pflegegrade vor, aber es ist nicht klar, welche Pflegeaufwände sich jeweils hinter einem Pflegegrad verbergen, vor allem im Vergleich zueinander. Für die Festsetzung von Leistungsbeträgen ist es aber schon relevant, wie viel mehr Aufwand zum Beispiel der Pflegegrad 4 zum Pflegegrad 3 macht. Darüber wissen wir empirisch wenig. Daher führen wir derzeit eine Studie durch, die die Versorgungsaufwände für Pflegebedürftige der fünf neuen Pflegegrade misst und vergleicht. Wir erheben eine Woche lang, welche Leistungen bei pflegebedürftigen Heimbewohnern ankommen. Und zwar die Leistung durch Pflegekräfte, Betreuungskräfte, Therapeuten, Angehörige. Diese Studie soll Ende Januar 2015 abgeschlossen sein. Natürlich bleibt die Festsetzung insbesondere der absoluten Leistung am Ende eine politische Frage. Wir werden die Zahlen offenlegen und aus fachlicher Sicht eine Einschätzung formulieren bzw. darauf hinweisen, welche Dinge bei der Leistungsbemessung berücksichtigt werden sollten. Ich hoffe, dass diese Leistungsaufwände dann bei der Leistungsbemessung berücksichtigt werden. Aber das letzte Wort hat die Politik.
Die Studie umfasst etwa 1.500 bis 1.700 pflegebedürftige Heimbewohner. Wieso bleibt die ambulante Pflege außen vor?
Grundsätzlich wäre es gut, die ambulante Pflege mit einzubeziehen, nur ist der Aufwand hierfür viel höher. Im stationären Bereich kann der Pflegebedürftige 24 Stunden lang beobachtet werden. Im ambulanten Bereich dagegen müsste man nicht nur die Leistungen erfassen, die durch den ambulanten Pflegedienst erbracht werden, sondern auch die Pflege durch Angehörige. Dabei ist man dann auf Befragungen angewiesen und derartige Befragungen sind notorisch unzuverlässig. Natürlich können die Ergebnisse aus dem stationären Bereich nicht eins zu eins auf den ambulanten übertragen werden, aber eine Studie für den ambulanten Bereich, die verlässliche Daten erhebt, ist in der kurzen verfügbaren Zeit nicht möglich. Dafür braucht man noch mal zwei bis drei Jahre mehr Zeit. Bis 2017 klappt das auf keinen Fall.
Was die Finanzierung betrifft, von welcher Größenordnung sprechen wir hier?
Die Kosten des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs hängen entscheidend davon ab, welche Leistungshöhen hinterlegt werden. Für die Festlegung der relativen Leistungshöhen sollte unsere Studie wichtige Hinweise geben. Für die absolute Höhe ist sicher zu beachten, dass die Leistungen der neuen Pflegegrade nicht hinter die der vergleichbaren Pflegestufen zurückfallen dürfen. Das ist sozusagen eine Untergrenze, deren Unterschreitung dazu führen würde, dass eine große Zahl zukünftiger Pflegebedürftiger durch die Reform schlechter gestellt wird. Dennoch kann es im Einzelfall natürlich dazu kommen, dass die neue Begutachtung ein für den Einzelnen schlechteres Ergebnis bringt. Das ist unvermeidlich, da Pflegebedürftigkeit besser erfasst werden soll, was dazu führt, dass einige höher und andere niedriger eingestuft werden. Daneben wird es eine Bestandsschutzregelung geben, die sicherstellt, dass die Leistungsansprüche der derzeitigen Leistungsempfänger zumindest nicht reduziert werden. Gehen wir davon aus, dass die neuen Leistungshöhen der Pflegegrade 2, 3 und 4 die der alten Pflegestufen I, II und III nicht unterschreiten, glaube ich nicht, dass die für 2017 geplante Erhöhung des Beitrags um 0,2 Beitragssatzpunkte, was in etwa 2,4 Milliarden Euro entspricht, ausreichen wird, um die entstehenden Mehrausgaben zu finanzieren. Wir bräuchten mindestens eine Milliarde Euro mehr. Dazu kommen noch die Kosten des Bestandsschutzes, die allerdings nur zeitlich begrenzt anfallen.
Was also bleibt zu tun?
Erstens müssen die Leistungshöhen für die Pflegegrade festgelegt werden. Zweitens müssen die Pflegesätze im stationären Sektor umgestellt werden. Derzeit orientieren sich die Pflegesätze an den Pflegestufen. Es muss sichergestellt werden, dass nicht allein durch die Umstellung auf Pflegegrade höhere Heimentgelte entstehen, ohne dass sich die Versorgung ändert. Die Vergütung im stationären Sektor ist eine Baustelle, um die es sich noch zu kümmern gilt, bevor der Pflegebedürftigkeitsbegriff eingeführt wird.
Dann gibt es noch das Gesetz zur Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. War das überfällig?
Die Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege und Berufstätigkeit ist von großer Bedeutung. Bereits 2008 wurde die einfache Pflegezeit ohne Lohnersatz und Rechtsanspruch eingeführt, und seit Januar 2012 gibt es die Familienpflegezeit. Diese Regelungen sind gut gemeint, wurden aber bislang kaum in Anspruch genommen. Für das ganze Jahr 2012 gab es bundesweit weniger als 200 Inanspruchnehmer. Ein Kernproblem war der fehlende Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit, der jetzt ins Gesetz hineingeschrieben wurde. Es gibt hunderttausende Pflegepersonen, die bereits heute ihre Berufstätigkeit aufgeben oder einschränken, weil sie familiale Pflegeaufgaben übernehmen. Insofern gibt es eine Zielgruppe für die Familienpflegezeit und ich halte das Gesetz im Prinzip für sinnvoll. Nur bin ich angesichts der vergangenen Erfahrungen skeptisch, ob die Zahl derer, die die Familienpflegezeit nutzen, massiv steigen wird.
Muss mehr für Pflegekräfte getan werden?
Heute leben etwa 70 Prozent der Pflegebedürftigen zu Hause, und knapp die Hälfte aller Pflegebedürftigen wird gepflegt, ohne dass eine Pflegeeinrichtung beteiligt ist. Allerdings ist der Anteil der Pflegebedürftigen in reiner Familienpflege seit Einführung der Pflegeversicherung rückläufig. Unsere Hochrechnungen zeigen, dass uns allein zur Aufrechterhaltung des heutigen Niveaus 2030 eine halbe Million Vollzeitbeschäftigte in der Langzeitpflege fehlen, wenn wir diesen Trend fortschreiben. Daher müssen wir alles stabilisieren und fördern: Familienpflege, zivilgesellschaftliches Engagement mit der Pflege im Quartier und professionelle Pflege durch Aufwertung des Pflegeberufs, z. B. durch bessere Entlohnung und strukturell bessere Arbeitsbedingungen. Die Zahl der Pflegebedürftigen wird sich bis 2050 verdoppeln, während das Erwerbspersonenpotenzial um ein Drittel zurückgeht. Um den Anteil des Erwerbspersonenpotenzials in der Pflege zu erhöhen, müssen die Arbeitsbedingungen in der Pflege deutlich verbessert werden.







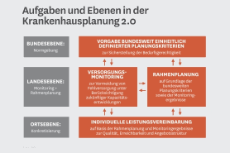


 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026
Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026
Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


