
Mit der strategischen und berufspolitischen Weiterentwicklung der Pflege beschäftigt sich Hedwig François-Kettner schon seit vielen Jahren – sowohl als langjährige Pflegedirektorin der Charité als auch in ihrer jetzigen Funktion als Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit (APS). Im Interview mit ersatzkasse magazin. spricht sie über die Anforderungen an eine qualitätsorientierte Gesundheitsversorgung mit Blick auf die Pflege und Patientensicherheit.
Sie engagieren sich seit vielen Jahren für die Pflege und eine patientenorientierte Versorgung. Woher rührt Ihre Motivation?
Insgesamt arbeitete ich 47 Jahre in verschiedenen Funktionen in der Pflege und bin immer wieder Dingen begegnet, bei denen ich dachte, das oder jenes müsste man ändern. Nur hat man im Alltag eingeschränkte Möglichkeiten. Doch diese Dinge haben mich nicht mehr losgelassen, wie zum Beispiel das ganz spannende Thema Qualitäts- und Risikomanagement. Mit der Zeit habe ich auch an unterschiedlichen Projekten des APS mitgearbeitet, angefangen mit der Broschüre „Aus Fehlern lernen“. Als ich für den Vorstand des APS angefragt wurde und mein Arbeitgeber, die Charité, mir volle Unterstützung zugesagt hat, war das eine spannende neue Herausforderung. Hier beschäftige ich mich nun mit allen möglichen Themen. Der Pflegebereich bleibt nach wie vor mein Zuhause. Da habe ich immer mit ganz viel Herz an der Basis gearbeitet, war auch später im Management immer nah an Personal und Patienten dran.
Wo steht Deutschland in der Pflege im internationalen Vergleich?
Wir haben einen hohen Nachholbedarf in strukturellen Fragen, was die Pflege betrifft. Auch was Inhalte, Entwicklungen und Kompetenzen etwa in der Krankenhauslandschaft und in nachfolgenden Bereichen anbelangt. Wir benötigen für alles Ärzte, was in anderen Ländern völlig anders ist. In Großbritannien, Australien oder den USA werden z. B. Krankenhäuser wesentlich durch die Pflegeprofis organisiert. Während einer Hospitation in der weltberühmten Mayo-Clinic in Minnesota konnte ich das umfassend kennenlernen. Ärzte sollten auch in Deutschland ihre Expertise und Kompetenzen in ihrem medizinischen Schwerpunkt einsetzen und nicht Verantwortung für Dinge übernehmen, die sie gar nicht wollen, wie Organisation und Ablaufoptimierung. Darin sind sich Ärzte und Pflegekräfte an der Basis durchaus einig, aber leider nicht die Funktionäre. Der Stellenwert der Pflege muss auch in Deutschland wachsen. Und wir brauchen mehr Pflegepersonal in den Krankenhäusern, in Pflege- und ambulanten Einrichtungen.
Sie sind auch Mitglied der Expertenkommission „Pflegepersonal im Krankenhaus“, da könnte man die Probleme ja anpacken.
Natürlich reden wir in der Expertenkommission mit Politik, den Krankenkassen und Vertretern der Krankenhäuser darüber, wie insgesamt die Pflege mehr Gewicht erhalten kann. In erster Linie soll es im Zuge der Expertenkommission aber darum gehen, dass wir für die Pflege in Deutschland ein Personalbemessungssystem aufbauen, was wenig bürokratisch ist, uns aber aufzeigt, wie der Pflegebedarf beim Patienten ist und womit man ihn bedienen kann. Es geht um die Frage nach der Personalbesetzung im Schichtdienst der unterschiedlichen Bereiche im Krankenhaus, um ein vernünftiges Maß an Betreuung zu gewährleisten. Wir beobachten einen relativ hohen Exodus ins Ausland. Die Absolventen in Deutschland gehen beispielsweise in die Schweiz oder nach Dänemark, sie verdienen dort mehr Geld und werden nach entsprechender Einarbeitungszeit mit wesentlich mehr Kompetenzen ausgestattet. Das dürfen wir uns überhaupt nicht leisten. Meine Hoffnung ist, dass in diesem Bereich jetzt auch durch das Krankenhausstrukturgesetz mit dem Pflegeförderprogramm, Pflegegeld und Pflegezuschuss und nachhaltig mit einem vernünftigen Personalschlüssel möglichst viel passiert.
Allerdings wurden schon 2009 bis 2011 einige Millionen Euro im Rahmen eines Pflegesonderprogramms zur Verfügung gestellt, das für mehr Pflegepersonal sorgen sollte. Das ist am Ende verpufft, unter dem Strich gab es nicht wirklich neue Stellen in der Pflege.
Wie wir sehen, hat es zwar einen Anstieg gegeben, der aber zu keinem nachhaltigen Standard führte. Der Abbau nach 2011 fand an vielen Stellen erneut statt. Das hat mich persönlich sehr geärgert. In der Charité hatten wir einen hohen Umfang an Förderstellen eingerichtet, aber es hat sich herausgestellt, dass wir die einzigen in Berlin waren, die darauf gebaut haben. Auch in den anderen Bundesländern wurde es unterschiedlich intensiv gehandhabt. Wir müssen jetzt zusehen, dass das nicht noch mal passiert. Ich denke, man muss an manchen Stellen Zweckbindungen einführen, sodass nachgewiesen werden muss, wofür die Mittel ausgegeben wurden. Denn solange man nicht explizit sagt, wofür die Gelder ausgegeben werden sollen, solange werden mit dem Argument der unternehmerischen Freiheit die Gelder entsprechend sonstiger Bedürfnisse umgewidmet.
Diskutiert die Expertenkommission in diesem Zusammenhang auch über eine Veränderung der Fallschauschalen, also DRGs, um die Pflege zu fördern?
Ich würde das machen, wenn ich dürfte. Denn letztlich ist das Konstrukt nur finanziell motiviert. In der Expertenkommission habe ich ein Beispiel gebracht: Wir leisten uns auf den deutschen Intensivstationen 88.000 nosokomiale Infektionen im Jahr, das sind insgesamt fast 600 Millionen Euro Kosten, abgesehen von dem immensen Leid, das damit verbunden ist. Es gibt aber aufgrund des DRG-Systems gar keinen Anreiz, auf diese Infektionen zu verzichten, weil diese dann nicht mehr im Budget enthalten wären. Das ist ein Systemfehler. Dazu kommen dann noch Kosten der Behandlung auf der normalen Station, unter Umständen auch der ambulanten Versorgung. Wenn wir diese großen Summen umwidmen könnten etwa in Pflegepersonal, müsste man schon Korrekturen im DRG-System vornehmen. Also damit mehr Anreize für die personelle Patientenversorgung setzen.
Meinen Sie denn, Dinge wie diese werden tatsächlich verändert?
Ich habe nicht den Eindruck, dass sich die Politik total dagegen wehrt. Notwendig ist aber eine gute Moderation, da viele Player am Tisch sitzen. Diese Rolle muss die Bundesregierung übernehmen. Generell muss man aber auch mal sagen, dass in letzter Zeit eine Menge angepackt wurde. Wenn ich an die Pflegethemen denke, wurden wir seit Langem überhaupt mal richtig ernst genommen. Der Wunsch nach Weiterentwicklung der Pflege war noch nie so stark wie jetzt. Die Pflegestärkungsgesetze, der Pflegebedürftigkeitsbegriff, die angestrebte generalisierte Pflegeausbildung, das alles sind wichtige Bausteine, damit die Pflege international wettbewerbsfähig wird.
Damit kommen wir zum Pflegeberufegesetz, das eine Generalisierung der Pflegeausbildung zum Ziel hat. Sie freuen sich darüber?
Ich freue mich sehr darüber. Es ist doch wunderbar, wenn erst einmal eine gemeinsame Basis-Qualifikation vorliegt, worauf dann die Spezialisierung aufsetzt. Bei den Medizinern ist es nicht anders, sie haben in übertragendem Sinn auch eine generalistische Ausbildung, bevor sie Fachärzte werden. Dort stellt es niemand infrage, bei der Pflege aber wird es unnötig verkompliziert. Dabei könnte ich mir auch vorstellen, dass gewisse Dinge von Pflegenden, Ärzten und Physiotherapeuten gemeinsam gelernt werden. Das würde die Interaktion und künftige Kommunikation positiv verändern und Distanzen abbauen, man würde mehr voneinander erfahren und Hemmschwellen würden abgebaut.
Kritiker befürchten, dass es für die Altenpflege schwieriger würde, Pflegekräfte zu halten, auch weil die Altenpflege im Vergleich schlechter bezahlt würde.
Was die Bezahlung angeht, liegt das Problem bei den Trägern. Hier muss dafür gesorgt werden, dass das Geld auch bei den Pflegekräften ankommt. 2014 lag die Rendite bei den Pflege- und Seniorenheimen bei 6,25 Prozent. Da wäre in eine vernünftige Personalbesetzung zu investieren einiges möglich. Mit Blick auf die Aufgaben und Tätigkeiten in den unterschiedlichen Pflegebereichen habe ich nicht die Erfahrung gemacht, dass junge Leute kein Interesse an der Altenpflege haben. Sie sind durchaus interessiert daran, auch mal in anderen Feldern zu arbeiten. Das macht den Pflegeberuf ja noch mal extra spannend, er hat eine unglaubliche Vielfalt, das sollten wir nutzen.
Wie begeistert man Pflegekräfte für strukturschwache Regionen?
Es gibt ganz viele Menschen, die auf dem Land leben möchten. Ich glaube, dass wir nirgendwo wirklich Probleme haben müssten. Wir müssen den Pflegeberuf lukrativer machen, und damit meine ich nicht nur finanziell. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir viel mehr mit ausländischen Kollegen arbeiten. In Spanien gibt es viele arbeitslose Pflegekräfte, und doch sind spanische Kollegen von hier wieder in ihre Heimat zurückgekehrt, weil sie in Deutschland so ein eingeschränktes Tätigkeitsfeld haben. Wir müssen den Pflegekräften mehr zutrauen und sie mitgestalten lassen. Zugleich sollten auch die Pflegekräfte mehr Mut haben und mehr Verantwortung einfordern. Insgesamt müssten die Aufgabenfelder und Abläufe neu definiert und strukturiert werden. Da sind einfach generell viele alte Zöpfe abzuschneiden.
Und wo stehen wir in Sachen Patientensicherheit und Qualität?
Zunächst würde ich sagen, dass wir bei den derzeitigen Bedingungen eine relativ gute Qualität haben, die dem hohen Einsatz des Personals zu verdanken ist. Auch in Bezug auf Patientensicherheit können wir uns durchaus sehen lassen. In den letzten Jahren haben wir eine ganze Menge geschafft. Nehmen wir die Aktion „Saubere Hände“, die ist ganz langsam angelaufen und inzwischen macht über die Hälfte aller Krankenhäuser mit – wichtig wäre aber, dass alle dabei sind. Oder schauen wir auf die Patientenbefragungen, die mittlerweile von knapp 98 Prozent der Krankenhäuser durchgeführt werden, wie die Krankenhausstudie des Instituts für Patientensicherheit aus dem letzten Jahr zeigt. Vor allem in den Krankenhäusern passiert zunehmend mehr. Wirklichen Handlungsbedarf sehen wir vor allem in den ambulanten Einrichtungen sowie teilweise in den Pflegeeinrichtungen. Diese müssen sich mehr öffnen und transparenter miteinander arbeiten. Das APS hat in diesem Jahr bei der Jahrestagung aber darauf aufmerksam gemacht, dass nur in zwei von 13 Gesundheitsfachberufen dem Thema „Patientensicherheit“ in der Ausbildung nachgekommen wird. Hier muss noch einiges geschehen, damit Patientensicherheit und Qualität systematisch im System entwickelt und verankert wird.
Wie sieht es mit der Schnittstelle stationär und ambulant aus?
Schlecht. Nehmen wir das Beispiel Medikationssicherheit, da wissen wir, dass großer Handlungsbedarf besteht, was die Medikamentengabe und das Medikamentenmanagement betrifft. Manchmal bringt der Patient eine Liste seiner Medikamente mit, manchmal nicht. Manchmal nimmt er Medikamente ein, die es in der Klinik nicht gibt, also stellt die Klinik um. Dann ist die Frage, wer umstellt. Auch der Apotheker müsste beteiligt werden, der Oberarzt. Die Krankenschwester im Nachtdienst muss ungestört die Medikamente stellen können. Es kommen so viele kleine Schritte zusammen, wir brauchen standardisierte Verfahren. Strukturen und Abläufe müssen gezielter und prozesshafter ausgestaltet werden. Der neu verabschiedete Medikationsplan der Bundesregierung ist noch nicht ausreichend und umfassend genug. Ein Medikationsplan ohne Medikationsanalyse und kontinuierliches Medikationsmanagement ist unvollständig. Und – ein Medikationsplan in Papierform alleine verbessert die Arzneimitteltherapiesicherheit nicht und kann nur ein erster Schritt sein. Wir im APS haben den Schwerpunkt für den Internationalen Tag der Patientensicherheit am 17. September in diesem Jahr auf die „Medikationssicherheit“ gelegt.
Woher rühren diese Probleme?
Sie entstehen fatalerweise überwiegend aufgrund mangelnder Kommunikation und Transparenz. Hier müssen wir in allen Versorgungsbereichen deutlich besser werden. Dabei beziehen sich Kommunikation und Transparenz sowohl auf die Zusammenarbeit von Arzt, Pflegekraft, Patient und Angehörigen, auf den Behandlungsverlauf als auch auf die Diskussion und Transparenz im Falle von Behandlungsfehlern. Das APS setzt sich im Sinne einer Sicherheitskultur stark dafür ein, dass wenn Fehler gemacht werden, nach Fallanalyse und Bewertung offen damit umgegangen wird. Dass man den Patienten und seine Angehörigen sofort einbindet, sodass sie und die Behandler gemeinsam interagieren. Dazu hat das APS die Broschüre „Reden ist Gold“ herausgebracht, die inzwischen schon zweimal vergriffen war und derzeit auch wieder neu aufgelegt wird. Der elektronischen Datentransparenz ist aus den genannten Gründen umgehend und schneller nachzukommen.
Werten Sie das als Signal, dass Patientensicherheit in Zukunft an Bedeutung gewinnt?
Das Bewusstsein für Patientensicherheit steigt, ganz klar, und das ist gut. Aber Patientensicherheit muss noch viel mehr mitgedacht werden, noch viel stärker integriert werden, z. B. in die Ausbildungen und Studiengänge von Gesundheitsberufen. Das Problem ist, dass Patientensicherheit ein Querschnittsthema ist und von allen Fachexperten immer mitgedacht und beachtet werden muss. Beispielhaft ist, dass die Universitätsklinik Bonn einen Lehrstuhl explizit für Patientensicherheit eingerichtet hat, der vom APS gefördert wird. Ich denke, dass wir Patientensicherheit vorantreiben und alle Beteiligten gewinnen müssen, sich konsentiert und konsequent auf den Weg zu machen.







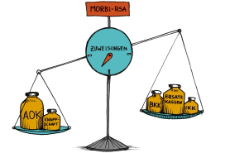


 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026
Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026
Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


