Bessere Behandlungsqualität, weniger Bürokratie und der Erhalt eines lückenlosen Netzes von Krankenhäusern in Deutschland sind die Ziele der Krankenhausreform. Der Intensivmediziner Prof. Dr. Christian Karagiannidis ist Mitglied der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung, die entsprechende Empfehlungen ausgesprochen hat. Er skizziert im Interview die Notwendigkeit einer Reform, die daran geknüpften Erwartungen sowie die Hürden in der Umsetzung.

Warum braucht es eine Krankenhausreform?
Prof. Dr. Christian Karagiannidis: Das Grundproblem ist, dass unser Krankenhaussystem, so wie es ist, nicht mehr funktioniert. Dabei sehe ich drei Kernprobleme. Erstens: Wir haben eine zerfledderte Krankenhauslandschaft mit zu vielen Standorten und kleinen Kliniken. Maximalversorger und Universitätskliniken haben wir genug, aber im Verhältnis dazu fehlt uns der Mittelbau, also mittelgroße Krankenhäuser der Schwerpunktversorgung. Das führt dazu, dass wir generell nicht zu wenig Personal haben, insbesondere Ärztinnen und Ärzte, sondern dass wir sie auf viel zu viel Angebot verteilen. Darunter leidet die Qualität. Zweitens: Die Altenpflege wird ein Riesenproblem werden in Deutschland, nicht nur die Finanzierung, sondern auch personell, was mir große Sorgen macht. Drittens: Wenn man den Patientenpfad verfolgt, stößt man immer wieder auf eine Mauer zwischen dem ambulanten und stationären Sektor. Ein Beispiel: Als Pneumologe behandele ich einen Patienten stationär und muss ihm dann sagen, dass er sich bitte einen Facharzt suche, anstatt dass ich ihm sagen kann, dass er bitte in drei Wochen nochmal wiederkommen möge, was für ihn das Beste wäre. Einen Teil dieser drei Kernprobleme haben wir als Regierungskommission adressiert und er findet sich auch in Form der vorgesehenen Maßnahmen in dem Kabinettsentwurf zur Krankenhausreform wieder.
Die Regierung ringt seit Monaten mit den Ländern um die Krankenhausreform auf Basis der Vorschläge der Regierungskommission. Wie zuversichtlich sind Sie noch, dass es zu einer Krankenhausreform wie ursprünglich geplant kommt?
Eines ist klar: Scheitern ist keine Option. Aber die Geister scheiden sich an der Frage: Will ich eine wirksame Reform, ja oder nein? Die Haltung der Krankenkassen finde ich grundsätzlich erstmal sehr gut, weil sie klar für eine Strukturoptimierung sind. Aber es gibt viele Stakeholder, die viel Geld im System verdienen und wollen, dass es so bleibt und eine entsprechend extreme Abwehrhaltung gegen eine echte Reform an den Tag legen. Wobei ich schon auch gut verstehen kann, dass die Länder und insbesondere die Kommunalpolitik Angst haben, weil es so viel Gegenwind gibt, sobald auch nur das kleinste, absolut nicht versorgungsrelevante Krankenhaus schließt. Am Ende muss man einen Kompromiss finden. Im Großen und Ganzen halte ich den Kabinettsentwurf immer noch für eine wirksame Reform. Wenn diese durchkommt, dann noch die Reform zur Notfallversorgung und zum Rettungsdienst, und wenn wir es dann noch schaffen, der Pflege mehr Kompetenzen zu geben, dann hätten wir viel erreicht in dieser Legislaturperiode. Man kann in vier Jahren nicht alles verändern, was 20 Jahre liegen geblieben ist, das klappt nicht.
Kommen wir zu konkreten Bausteinen der Reform. Eine zentrale Maßnahme, um die Qualität und Vergleichbarkeit von Krankenhäusern zu verbessern, ist die Einführung von Leistungsgruppen. Den Krankenhäusern sollen verschiedene Leistungsgruppen zugeordnet werden. Dabei hat man sich an dem Modell in Nordrhein-Westfalen orientiert. Was steckt dahinter?
Leistungsgruppen einfach erklärt bedeutet, dass wir große Fachabteilungen, wie wir sie jetzt haben, zum Beispiel Kardiologie, in Zukunft in verschiedene Blöcke aufteilen, die inhaltlich zusammenpassen, aber deutlich spezifischer sind. Voraussetzung für die Zuweisung einer Leistungsgruppe ist die Erfüllung von bundeseinheitlichen Qualitätskriterien. Das finde ich grundsätzlich erstmal einen großen Fortschritt. An dieser Stelle muss man NRW auch loben dafür, dass sie Leistungsgruppen eingeführt haben. Mir sind es mit den vorgesehenen 65 Leistungsgruppen allerdings zu wenige. Als Regierungskommission haben wir 128 vorgeschlagen. Umso mehr kommt es jetzt darauf an, wie man die Mindeststrukturvoraussetzungen ausgestaltet. Dazu gehört insbesondere, wie viel Personal verpflichtend vorgehalten werden muss, denn das ist eins zu eins mit Qualität verknüpft. Die NRW-Strukturvoraussetzungen sind sehr schwach und werden wenig Veränderung hervorrufen. Man muss diese nun weiterentwickeln, die Leistungsgruppen und ihre Strukturvoraussetzungen sollte man nicht als ein statisches System betrachten.
Kommt es nicht jetzt zu Aufweichungen, weil unter anderem die Weiterentwicklung der Leistungsgruppen in einer extra Rechtsverordnung nach Verabschiedung des Gesetzes geregelt werden soll?
Die Gefahr besteht prinzipiell, eine dauerhafte Aufweichung wäre aber fatal für die Wirksamkeit der Reform. Zeitlich begrenzte Ausnahmen in einer sich jetzt schnell wandelnden Welt sind aber sicher hilfreich, um regional die Versorgung zu sichern. Am besten regelt man die Weiterentwicklung gleich mit.
Zudem soll es möglich sein, die Qualitätskriterien durch Kooperationen zu erfüllen.
Kooperationen würde ich nur in Ausnahmen zulassen, und zwar dann, wenn es um hochelektive Eingriffe geht. In dem Moment, wo ich bei Eingriffen Komplikationen habe, sind Kooperationen extrem risikobehaftet für die Patienten, weil es manchmal im wahrsten Sinne des Wortes um Minuten geht. Es muss jemand am Standort sein, es kann nicht sein, dass, wenn dem Patienten etwas passiert, die Kooperationsklinik 30 Kilometer entfernt liegt. Wenn man es regional nicht anders hinbekommt, weil die Strukturen schon so schwach sind, da haben wir ja einige Regionen in Deutschland, dann ist das eine Krücke, die man machen muss. Aber Ausnahmen für Ballungsgebiete sind völlig kontraproduktiv und gehen zulasten des Patientenschutzes.
Eine weitere Maßnahme ist die Vorhaltevergütung. Was versprechen Sie sich davon?
Vorgesehen ist, die Gelder in Zukunft weiterhin mit 40 Prozent über den DRG-Anteil auszuschütten und 60 Prozent über Vorhaltevergütung, was auch richtig ist. Man darf das System auf keinen Fall umstellen auf irgendeine Form der Selbstkostendeckung, es braucht eine ökonomische Komponente. Aber 60 Prozent Vorhaltevergütung sind eine Menge, vor allem auch, weil die Kliniken in einem Korridor von 20 Prozent eine Budgetkonstanz bekommen, was einmalig ist. Das heißt, selbst wenn sie weniger Leistung erbringen, erhalten sie das gleiche Geld. Deswegen hat die Vorhaltevergütung grundsätzlich einen strukturkonservierenden Effekt, womit man die Überökonomisierung ein Stück weit zurückfährt. Wir müssen jetzt noch abwarten, wie die Mindestfallzahlen als Voraussetzung für den Erhalt der Vorhaltevergütung ausgestaltet werden, das soll auch per Verordnung geregelt werden. Mindestfallzahlen halte ich aus ökonomischer Sicht für gerechtfertigt, denn für die Einführung der Vorhaltevergütung kann der Gesetzgeber im Gegenzug etwas erwarten. Es kann ja nicht sein, dass er für nur einen Fall pro Jahr Vorhaltevergütung ausschüttet. Insgesamt müssen wir zusehen, dass die Strukturvoraussetzungen relativ gut ausdifferenziert sind, damit wir Geld nicht mit der Gießkanne ausschütten. Da werden die weiteren Verhandlungen noch mal spannend werden.
In der Vorhaltefinanzierung soll künftig auch das Pflegebudget enthalten sein.
Das ist ein großes Problem. Das Pflegebudget hat derzeit eine Selbstkostendeckung, was auch sinnvoll ist, den Grundgedanken unterstütze ich maximal. Nur ist daraus leider geworden, dass die Krankenhäuser anfangen, Pflegekräfte vom Markt abzugreifen und diese für Transporte oder Ähnliches einzusetzen, weil diese ja zu 100 Prozent refinanziert sind, im Gegensatz etwa zu Servicekräften. Damit entziehen wir vor allen Dingen der Altenpflege und der ambulanten Pflege unglaublich viel Personal, weil wir im Krankenhaus insgesamt höhere Gehälter zahlen. Entsprechend wird das Ganze mit der Selbstkostendeckung der Pflege im Krankenhaus, so toll und unterstützenswert es ist, dazu führen, dass Altenpflege und ambulante Pflege die Verlierer sein werden. Dazu kommt, dass wir seit Einführung des Pflegebudgets 2020 jährliche Steigerungen von zehn Prozent im Pflegebudget haben. Da müssen wir aufpassen, dass es nicht übers Ziel hinausschießt, hier brauchen wir feste Spielregeln.
Geregelt ist auch, dass sogenannte Level 1i-Krankenhäuser, die als Grundversorger ohne Notaufnahme zum Einsatz kommen, ausgerechnet keine explizite Vorhaltevergütung bekommen sollen.
Daraus wurde im Kabinettsentwurf das Konzept der sektorenübergreifenden Versorgungseinrichtungen. Dabei handelt es sich um eine ganz neue Versorgungsform, die wir im Moment nicht haben, aber unbedingt benötigen, weil sie genau die Einrichtung ist, die uns fehlt. Die sektorenübergreifende Versorgungseinrichtung ist weiterhin ein Krankenhaus, aber sie macht keine Notfallversorgung und nach Möglichkeit auch keine hochtechnisierte Medizin, vielmehr geht es um pflegerische Versorgung. Zudem ist unser Ambulantisierungsgrad im internationalen Vergleich minimal und wir würden viel Entlastung herbeiführen, wenn wir weniger Patienten stationär und deutlich mehr ambulant behandeln würden. Dies kann gerade auch angeschlossen an solche Level 1i-Kliniken passieren. Sie sind ein Anlaufpunkt, der für die Versorgung gerade der älteren Bevölkerung unheimlich wichtig ist. Derzeit kommen viele Menschen aus dem Pflegeheim in die Notaufnahme, werden also eingewiesen beim Maximalversorger, obwohl sie bei einem Level 1i-Krankenhaus auch gut versorgt würden. Und wir haben mehr als genug Krankenhäuser, die man umwandeln kann. Das Level 1i-Krankenhaus erhält keine Vorhaltevergütung, weil uns die gute pflegerische Versorgung wichtig erscheint und daher Pflegetagessätze im Vordergrund stehen. Auch ist der Anreiz, zu viel unnötige Technik einzusetzen, minimiert.
Wie wirkt sich die Reform insgesamt finanziell aus? Ursprünglich wurde gesagt, dass die Klinikreform unter dem Strich kostenneutral sein soll.
Im Moment kann man schwer absehen, wie gut die Reform ökonomisch wirkt und ob es letzten Endes zu Einsparungen oder Mehrbelastungen kommt. Man muss zwei Dinge voneinander trennen. Zum einen haben wir die stetige Leistungsausweitung. Wir hatten schon wieder eine Leistungssteigerung Anfang des Jahres und diese Leistungssteigerungen werden irgendwann dazu führen, dass das System nicht mehr bezahlbar ist. Auf die Krankenkassen kommen ja nicht nur Kosten der stationären Versorgung zu und alleine hier werden wir dieses Jahr vermutlich erstmals die 100 Milliarden Euro knacken, wenn das so weitergeht. Dazu kommen in Zukunft noch die großen Medikamentenausgaben, zum Beispiel die Abnehmspritze oder im Bereich der onkologischen Therapien, und dann kommt natürlich das riesige Pflegeproblem auf uns zu. Das heißt, wir brauchen in irgendeiner Form jetzt einen Deckel.
Der Umbau der Krankenhauslandschaft soll durch den Transformationsfonds finanziert werden. Dagegen laufen die Krankenkassen Sturm, weil sie dieses Vorhaben als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe betrachten, die der Staat zu finanzieren hat.
Vorgesehen ist, dass ab 2026 für den Zeitraum von zehn Jahren pro Jahr jeweils 2,5 Milliarden Euro aus dem Gesundheitsfonds entnommen werden, weitere 2,5 Milliarden Euro tragen die Länder. Da haben sich die Krankenkassen auch zum Teil zu Recht beschwert. Nur würde ich es sehr unterstützen, wenn man bei dieser Finanzierungsform bleibt, aber den Krankenkassen dafür ein Mitspracherecht einräumt. Wenn sie bei der Verteilung der Gelder aus dem Transformationsfonds mitreden könnten, wären die Beitragsgelder auch wirklich sinnvoll ausgegeben. Auf jeden Fall lohnt sich der Transformationsfonds, er birgt einen extrem wichtigen Einmaleffekt, durch den sich hinterher Einsparungen erzielen lassen, weil eben eine Transformation stattfindet.
Sollte sich nicht auch der Bund an der Finanzierung beteiligen?
Der Bund wird aus einer gewissen Verpflichtung nicht herauskommen. Aber man muss auch schauen, wie sich die nächsten Jahre entwickeln. Da ist zum Beispiel noch eine Pflegeversicherung, die extrem stabilisiert werden muss, da sind die Beiträge der gesetzlichen Krankenversicherung in einem starken demografischen Wandel. Da kommt noch eine Menge auf den Bund zu.
Inwieweit ist zu befürchten, dass die Bundesländer ihrer Verpflichtung zur Finanzierung des Transformationsfonds nicht nachkommen? Diese halten sich bei der Investitionskostenfinanzierung ja schon lange zurück.
Sich aus der Verantwortung zu nehmen und nur Forderungen zu stellen, das fände ich nicht richtig. Aber es wird sehr stark von der Einnahmeseite abhängen. Man muss bedenken, dass sich die Schuldenbremse des Bundes auch direkt auf die Länder auswirkt. Auch die Länder werden nicht ohne Weiteres Schulden machen, stattdessen auf Einsparungen pochen. Insofern ist vieles abhängig von unserem weiteren Wirtschaftswachstum. Im Kern glaube ich, dass wir in Deutschland zur Stabilisierung unserer Sozialsysteme Wirtschaftswachstum brauchen, und daran werden die Länder letzten Endes hängen.
Sie sprechen sich dafür aus, die Krankenhausreform mit der Notfallreform anzugehen. Was erwarten Sie hier?
Ich würde schon erwarten, dass ein Gesetzentwurf kommt. Der Wunsch der Regierungskommission beinhaltet drei große Hebel. Das eine ist die Zusammenführung der 116 117 mit der 112, also dass man eine direkte Patientensteuerung macht. Zweitens sollten wir endlich eine KV-Praxis am Haus haben, damit nicht immer alle in die Notaufnahmen strömen. Das wäre ein Riesenschritt vorwärts. Und dann, womit sich die meisten ja schwertun, wäre es gut, den Rettungsdienst in das SGB V als Leistungserbringer zu kriegen. Das würde auch die Tür öffnen zum Konzept „Treat at Home“, also dass Patienten zu Hause behandelt werden. Das ist eine riesige Chance, auch mit Blick auf die Versorgung älterer Menschen. Denn im Moment muss der Rettungsdienst den Patienten in die Notfallaufnahme bringen. Aber wenn der Rettungsdienst im SGB V enthalten ist, hätte er die Möglichkeit, vor Ort zu behandeln. Das wäre eine große Entlastung für die Krankenkassen sowie Kliniken und birgt großes Einsparpotenzial und vor allem für ältere Patienten ihr gewohntes häusliches Umfeld.
Weitere Artikel aus ersatzkasse magazin. (3. Ausgabe 2024)
-
 Interview mit Prof. Dr. Christian Karagiannidis, Mitglied der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung
Interview mit Prof. Dr. Christian Karagiannidis, Mitglied der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung„Scheitern ist keine Option“












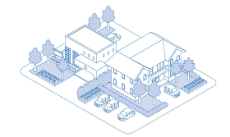


 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026
Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026
Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


