Der Arzneimittelmarkt ist geprägt von stark steigenden Preisen, beispielsweise bei den Orphan Drugs, den Arzneimitteln zur Behandlung seltener Krankheiten. Zugleich gelangen immer mehr neue Arzneimittel auf den Markt, auch weil Pharmaunternehmen inzwischen ihre Produktivitätskrise überwunden haben. Dazu kommen Fragen der Arzneimittelsicherheit, auf welche die Politik mit einem neuen Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) reagiert.
Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft (AkdÄ), engagiert sich seit Jahren für eine sichere und nutzenorientierte Arzneimittelversorgung. Im Interview mit ersatzkasse magazin. spricht er über Entwicklungen im Arzneimittelmarkt, über das Problem hochpreisiger Medikamente und über die Rolle der Ärzteschaft mit Blick auf rationale Pharmakotherapie.

Neben Ihrer Tätigkeit als Hämatologe und Onkologe sind Sie Vorsitzender der AkdÄ und Herausgeber des Arzneimittelbriefes. Ecken Sie häufig an?
Mit dem Arzneimittelbrief, der als ein unabhängiges Informationsblatt neue, aber auch im Markt etablierte Arzneimittel kritisch kommentiert und dabei versucht, die Spreu vom Weizen zu trennen, ecken wir tatsächlich häufig an. Konstruktiver Diskurs mit unseren Lesern ist dabei prinzipiell erwünscht, beispielsweise wenn wir uns für eine eher restriktive Verordnung direkter oraler Antikoagulanzien aussprechen. Auch in der AkdÄ versuchen wir unter den vielen neuen Arzneimitteln, die heute von Pharmaunternehmen grundsätzlich als Innovationen bezeichnet werden, echten – aber leider seltenen - therapeutischen Fortschritt zu erkennen und in unseren Stellungnahmen anhand von Ergebnissen aus methodisch einwandfreien klinischen Studien zu bewerten. Ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit in der AkdÄ ist die Arzneimittelsicherheit, aber auch die Arzneimitteltherapiesicherheit, also die Vermeidung von Medikationsfehlern.
Wie hat sich der Arzneimittelmarkt in den letzten Jahren entwickelt?
Aufgrund der abgelaufenen Patente für sogenannte Blockbuster – Arzneimittel, die weltweit einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro im Jahr erzielen - für Volkskrankheiten im Zeitraum von 2000 bis 2010, mussten Pharmaunternehmen neue lukrative Anwendungsgebiete für ihre Wirkstoffe suchen. Sie waren zweifellos erfolgreich bei dieser Suche und haben dabei unter anderem von der 2000 in Kraft getretenen Verordnung (EG) Nr. 141/2000 zu Arzneimitteln für seltene Leiden profitiert, aber auch von den Erfolgen in der Grundlagenforschung, beispielsweise auf dem Gebiet der Krebserkrankungen durch eine genauere Charakterisierung molekulargenetischer Veränderungen in Tumorzellen, aber auch durch eine Weiterentwicklung immuntherapeutischer Strategien. Dies spiegelt sich auch in einem Trend wider, der nun bereits seit einigen Jahren im Arzneimittelmarkt zu beobachten ist: stetige Zunahme an Immuntherapeutika und Arzneimitteln zur Behandlung von Krebserkrankungen, darunter zahlreiche Orphan Drugs, sowie immer weniger Arzneimittel, die als erster Vertreter einer neuen Wirkstoffklasse zugelassen werden. Darüber hinaus werden heute weit mehr als 50 Prozent der neuen Arzneimittel für die Anwendungsgebiete Onkologie, Infektionskrankheiten (vor allem Hepatitis C), Neurologie und chronisch-entzündliche Erkrankungen zugelassen, da sie besonders lukrativ sind, und Forschungsaktivitäten in anderen, weniger erfolgversprechenden Anwendungsgebieten eher heruntergefahren. Ein Grund für diese Entwicklung ist, und ich sage es mal bewusst provokativ, dass die Pharmaunternehmen es in diesen Anwendungsgebieten geschafft haben - wahrscheinlich auch durch interne Absprachen -, ein sehr hohes Preisniveau zu etablieren. Die Jahrestherapiekosten, beispielsweise zur medikamentösen Behandlung des malignen Melanoms, liegen heute bereits – abhängig davon, ob eine Mono- oder Kombinationstherapie erfolgt – zwischen 100.000 und 300.000 Euro pro Patient.
Eine weitere Ursache für hohe Therapiekosten wird in dem Zulassungsverfahren von Orphan Drugs auf europäischer Ebene gesehen.
Ja, die deutliche Zunahme an beschleunigten Zulassungsverfahren – sowohl in den USA als auch in Europa –, von denen auch die vielen neuen Orphan Drugs profitieren, ist sicher ein Problem, da neue Arzneimittel mit immer weniger gesicherten Erkenntnissen zu Wirksamkeit und Sicherheit auf den Markt kommen.
Wie lässt sich dem Trend zu hochpreisigen Arzneimitteln entgegenwirken?
Ein wichtiger erster Schritt war sicher das 2011 – vor dem Hintergrund rasant gestiegener Arzneimittelpreise - in Kraft getretene Gesetz zur Neuordnung des Arzneimittelmarktes (AMNOG). Dieses Gesetz verfolgte das Ziel, anhand einer Bewertung des Zusatznutzens neuer patentgeschützter Arzneimittel gegenüber einer zweckmäßigen Vergleichstherapie, eine am therapeutischen Stellenwert orientierte Preisfindung zu ermöglichen. Das laut Arzneiverordnungs-Report 2018 mit diesem Instrument im Jahr 2017 erwirtschaftete Einsparvolumen von circa 1,75 Milliarden Euro verdeutlicht die Wirksamkeit des AMNOG. Genauso wichtig ist aber aus meiner Sicht, dass wir mit dem transparenten Verfahren der frühen Nutzenbewertung durch das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG), dem sich daran anschließenden Stellungnahmeverfahren, an dem sich auch die AkdÄ häufig beteiligt, und dem Beschluss zum Zusatznutzen durch den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) deutlich mehr unabhängige Informationen zur Wirksamkeit und Sicherheit neuer Arzneimittel erhalten als durch Publikationen in den Fachzeitschriften oder Verlautbarungen der Pharmaunternehmen. Wenn diese Informationen jetzt auch noch besser und schneller bei den Ärzten ankommen, die diese neuen und häufig teuren Arzneimittel verordnen, wäre dies wirklich ein großer Fortschritt. Inwieweit das AMNOG geeignet ist, auch bei neuartigen Therapieverfahren, wie beispielsweise CAR-T-Zellen, eine vernünftige, am Nutzen orientierte Preisbildung zu garantieren, bleibt abzuwarten.
Und wie sieht es bei Orphan Drugs aus?
Die mit der Gesetzgebung in Europa, ebenso wie in den USA und Japan, eingeräumten finanziellen Anreize für die Entwicklung von Orphan Drugs haben dazu geführt, dass auch große Pharmaunternehmen diesen Bereich des Arzneimittelmarktes inzwischen als äußerst lukratives Geschäftsmodell erkannt haben. Seit Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 141/2000 sind etwa 120 derartige Arzneimittel zugelassen worden, darunter mehr als ein Drittel für die Behandlung onkologischer Krankheiten. Auch die aktuellen Prognosen zum weltweiten Umsatz der Orphan Drugs im Jahr 2024 – jährliches Wachstum um elf Prozent, Anstieg des globalen Umsatzes auf etwa 262 Milliarden US-Dollar im Jahr, 16 von 20 der umsatzstärksten Medikamente zugelassen für die Behandlung hämatologischer beziehungsweise onkologischer Krankheiten – erklärt die Goldgräberstimmung der Pharmaunternehmen in diesem Bereich. Diese Entwicklung, bei der leider nicht die wirklich seltenen, genetisch bedingten Krankheiten im Mittelpunkt der Forschung stehen, widerspricht eindeutig dem Geist der Verordnung: Förderung und Entwicklung von Arzneimitteln mit großem Aufwand für die klinische Erforschung und geringer Nachfrage.
Außerdem gilt bei Orphan Drugs – für mich unverständlicherweise – der Zusatznutzen nach der Verordnung (EG) 141/2000 als belegt und der G-BA beurteilt nur noch das Ausmaß des Zusatznutzens. Die Mängel in den für die Zulassung von Orphan Drugs relevanten Studien sind in zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen gezeigt worden. Die Tatsache, dass bei mehr als der Hälfte der seit 2011 vom G-BA durchgeführten Nutzenbewertungen der Zusatznutzen von Orphan Drugs nicht quantifizierbar war, verdeutlicht einerseits, dass wir dringend weitere klinische Studien nach Zulassung benötigen, andererseits auch bei Orphan Drugs eine reguläre Nutzenbewertung erfolgen sollte. In dem GSAV, das aktuell diskutiert wird, ist zwar vorgesehen, dass der G-BA künftig von den Herstellern anwendungsbegleitende Datenerhebungen nach der Zulassung anfordern kann. Wie diese Erhebungen allerdings konkret aussehen und welche Art klinischer Studien hierfür durchgeführt werden sollen, bleibt leider unklar.
Sind die Biosimilars, also Nachfolgepräparate der Biologika, eine alternative Versorgungsoption?
Bereits 2008 hatte sich die AkdÄ eindeutig geäußert und empfohlen, dass anstatt eines Originalpräparats ein Biosimilar eingesetzt werden kann, wenn es durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) zugelassen wurde. Damals gab es viel Gegenwind, auch von medizinischen Fachgesellschaften, und Desinformationen wurden gezielt verbreitet, etwa die Aussage: „Biosimilars sind nur ähnlich, aber nicht identisch mit den Originalpräparaten“. Dabei wurde übersehen, dass jede neue Charge eines Biologikums auch nur ähnlich ist wie die vorausgegangene Charge. Unsere Empfehlungen im Leitfaden 2017 der AkdÄ zur Verordnung von Biosimilars lauten deshalb: „Biosimilars sind bezüglich der therapeutischen Wirksamkeit, der Verträglichkeit und der Sicherheit in allen zugelassenen Indikationen des jeweiligen Referenzarzneimittels gleichwertig und können wie dieses eingesetzt werden“. Wichtig wird jetzt sein, dass entsprechend dem Sprichwort „Konkurrenz belebt das Geschäft“ ein funktionierender Wettbewerb in Gang kommt, so wie wir es aktuell erfreulicherweise bei den Biosimilars zu Adalimumab erleben – dem heute weltweit umsatzstärksten Arzneimittel, dessen Patent ausgelaufen ist. Bisher waren Biosimilars, die in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind, nur zehn, bestenfalls 20 Prozent günstiger als die Originalpräparate. Bei Biosimilars zu Adalimumab liegen die Preise jedoch bereits circa 40 Prozent unter dem Originalpräparat. Dies bedeutet ein großes Einsparpotenzial, das auch bei anderen Biosimilars durch mehr Konkurrenz und Wettbewerb gehoben werden sollte.
Sie fordern, dass nur der verordnende Arzt eine Umstellung vom Originalpräparat auf ein Biosimilar vornehmen darf.
Die AkdÄ hat sich vehement dafür eingesetzt, dass eine automatische Substitution, ähnlich dem Autidem bei Generika, derzeit nicht stattfindet. Diese wurde anfangs im GSAV gefordert, dann aber wieder, zumindest für die nächsten drei Jahre, gestrichen, was mich freut. Denn zum einen wollen wir natürlich im Rahmen der rationalen Pharmakotherapie wirtschaftlich verordnen, zum anderen wollen wir die Patienten gut informieren und behandeln. Dazu gehört, dass die Patienten – meist mit chronisch verlaufenden Krankheiten - ausführlich in einem zeitaufwändigen Gespräch über eine Umstellung auf ein neues Biologikum informiert werden müssen, damit sie nicht verunsichert sind und denken, das Biosimilar sei einfach nur billiger, deshalb möglicherweise auch weniger wirksam und führe zu mehr Nebenwirkungen. Aus Sicht der AkdÄ wäre es gerade jetzt wichtig, da immer mehr Biosimilars auf den Markt kommen, Patienten, aber auch Ärzte sachgerecht über ihre Verordnung zu informieren und unbegründete Skepsis zu beseitigen. Daher halte ich eine automatische Substitution im Augenblick für eine schlechte Idee.
Wie können Ärzte beurteilen, welche Medikamente geeignet sind?
Ich wünsche mir, dass von Pharmaunternehmen unabhängige Informationsquellen, wie beispielsweise unabhängige Arzneimittelbulletins und Stellungnahmen der AkdÄ, noch stärker genutzt werden. Wir wissen heute aus zahlreichen Studien, dass vor allem finanzielle Interessenkonflikte – etwa durch finanzielle Beziehungen zu Pharmaunternehmen – die Gefahr erhöhen, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis von Arzneimitteln verzerrt bewertet wird. Ähnliches passiert häufig bei Fortbildungsveranstaltungen, die von Pharmaunternehmen gesponsert werden und bei denen die eingeladenen Referenten somit Interessenkonflikten unterliegen. Der Fachausschuss Transparenz und Unabhängigkeit der AkdÄ hat deshalb bereits vor drei Jahren Regeln für Fortbildungsveranstaltungen erarbeitet, damit im Rahmen der Fort- und Weiterbildung unabhängige Empfehlungen hinsichtlich der bestmöglichen, sicheren und wirtschaftlichen Therapie für unsere Patienten im Vordergrund stehen und nicht Marketinginteressen der Pharmaunternehmen.
Zum Schluss noch ein Blick auf Arzneimittelsicherheit. Die Politik bringt das GSAV unter anderem als Reaktion auf die Skandale Valsartan und Lunapharm auf den Weg. Wie bewerten Sie das Gesetz?
Die raschen Reaktionen auf die zuvor genannten Arzneimittelskandale im GSAV sind zunächst sicher positiv zu bewerten. Besonders wichtig erscheint mir, dass die Kommunikation zwischen den Arzneimittelaufsichtsbehörden in den Ländern, die für die Arzneimittelsicherheit vor Ort zuständig sind, und den Bundesoberbehörden (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Paul-Ehrlich-Institut) besser funktioniert. Ein weiterer Punkt, der auch durch die Vorgänge um Lunapharm noch einmal ins Bewusstsein der für die Arzneimittelsicherheit Verantwortlichen gebracht wurde, ist die Importquote, insbesondere hinsichtlich des Imports von Arzneimitteln, bei denen hohe Anforderungen an Lagerung und Kühlung (wie beispielsweise bei Krebsmedikamenten) erfüllt werden müssen. Deshalb haben sich auch die Vertreter der Ärzte- und Apothekerschaft einmütig bei der Anhörung zum GSAV im Bundesministerium für Gesundheit für die Abschaffung der Importquote ausgesprochen. Die aus der Importquote resultierenden Ersparnisse stehen aus meiner Sicht in keiner Relation zu den Risiken für die Arzneimittelsicherheit. Leider hat sich aber offensichtlich im Kabinettsentwurf des GSAV die Lobbyarbeit der Importeure und nicht die Vernunft durchgesetzt. Dies halte ich persönlich für einen großen Fehler.
Weitere Artikel aus ersatzkasse magazin. 1. Ausgabe 2019
-
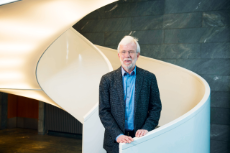 Interview mit Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig
Interview mit Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig„Ich wünsche mir, dass von Pharmaunternehmen unabhängige Informationsquellen stärker genutzt werden“






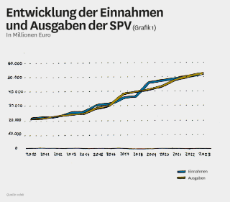



 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026
Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026
Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


