Der Bundestag hat am 7. November 2019 das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) beschlossen. Damit wird die Digitalisierung weiter vorangebracht. Aber im Detail bleiben einige offene Fragen.
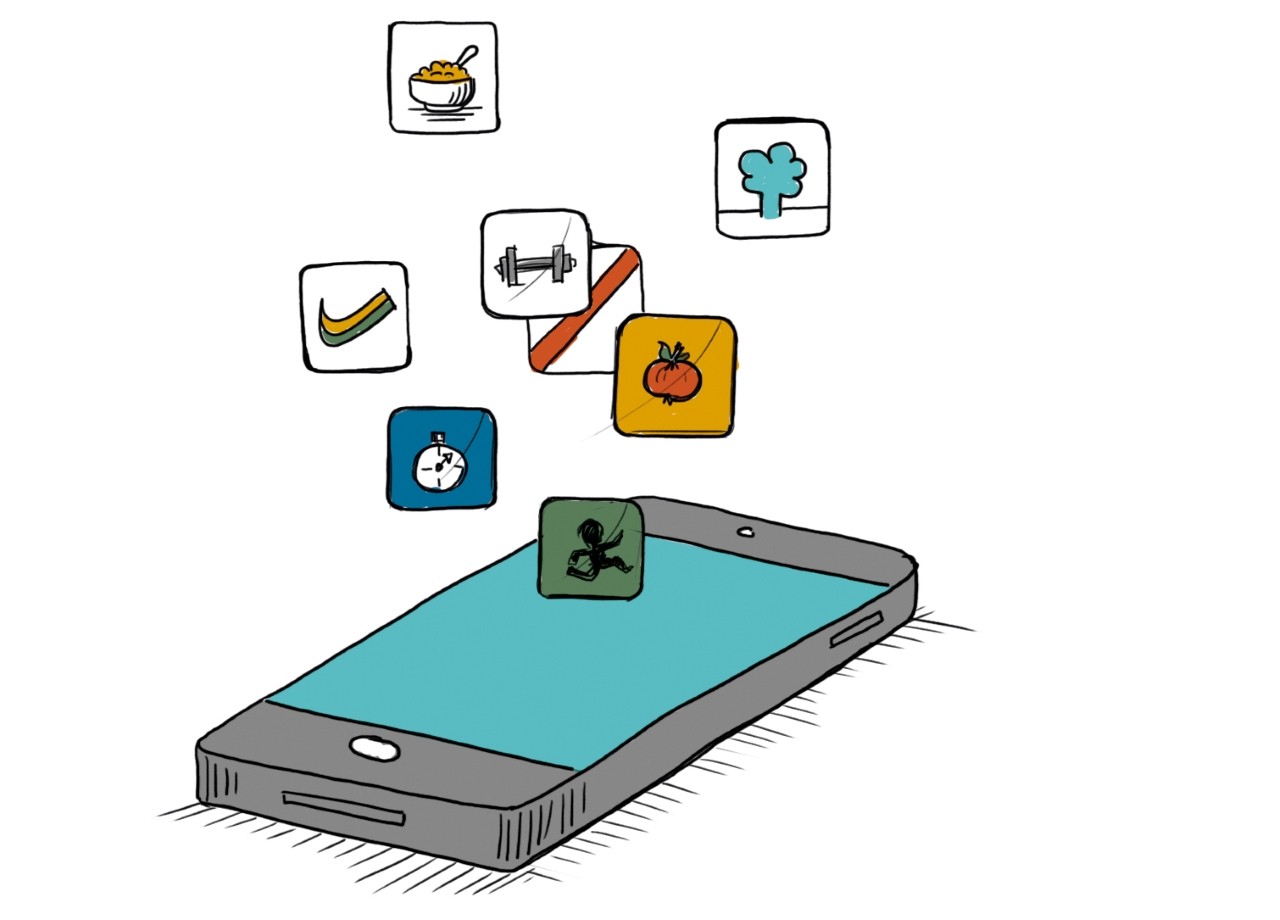
Im Mittelpunkt des DVG steht die Einführung von Apps auf Rezept. Damit wird es zukünftig möglich sein, nach Verordnung durch einen Arzt oder Genehmigung der Krankenkasse digitale Gesundheitsanwendungen zu nutzen. Die Ersatzkassen haben ihren Versicherten bereits frühzeitig solche Angebote über Satzungsleistungen oder Selektivverträge zugänglich gemacht. Mit dem neuen Gesetz sollen nun erstmalig alle Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) Zugriff auf diese neuen Möglichkeiten erhalten, zum Beispiel zur digitalen Therapieunterstützung oder zum Selbstmanagement insbesondere chronischer Erkrankungen.
Bis die erste App verordnet wird, ist jedoch noch eine Reihe von Fragen zu klären. Aus Sicht der Ersatzkassen können nur solche Anwendungen durch die Krankenkassen erstattet – und damit durch die Versichertengemeinschaft bezahlt – werden, die einen nachgewiesenen Nutzen bieten. Für diese Prüfung hätten sich die Gremien der gemeinsamen Selbstverwaltung angeboten, die eine lange Erfahrung in der Bewertung neuer Behandlungen auf Basis der Maßstäbe der evidenzbasierten Medizin haben. Stattdessen hat sich der Gesetzgeber dafür entschieden, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zu beauftragen.
Welche Kriterien für die Bewertung von Medizin-Apps herangezogen werden sollen, ist derzeit noch unklar. Hierzu wird das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) eine Rechtsverordnung erlassen, mit der im ersten Quartal 2020 gerechnet wird. Grundlage dürften auch die Ergebnisse verschiedener Gutachten sein, die das Ministerium in Auftrag gegeben hat.
Nachweis der medizinischen Qualität
Wichtig ist aus Sicht der Ersatzkassen, dass neue digitale Angebote in ihrem medizinischen Outcome mindestens gleichwertige Ergebnisse liefern wie bisherige „analoge“ Therapien. Daneben sollten auch andere Versorgungseffekte eine Rolle spielen, wie etwa eine Vereinfachung der Prozesse. Die Priorität muss jedoch klar auf der medizinischen Qualität liegen, die durch hochwertige Studien nachgewiesen sein muss.
Viele Anbieter digitaler Anwendungen, die bereits heute über Selektivverträge im GKV-Markt aktiv sind, können solche Studienergebnisse bereits vorweisen. Liegen sie noch nicht vor, sind aber zu erwarten, kann dies zukünftig im Rahmen einer Erprobung direkt in der Versorgung untersucht werden. Das ist ein richtiger Weg, um potenziell gute Angebote frühzeitig den GKV-Versicherten zur Verfügung zu stellen. Gleichzeitig kommt es auch hier auf die konkreten Bedingungen für die Teilnahme an einer Erprobung an. Denn eine – auch nur zeitweise – Kostenübernahme durch die GKV darf kein Programm zur Wirtschaftsförderung von Anbietern von Apps werden, die sich im Nachhinein als nutzlos herausstellen.
Dies gilt umso mehr, als im ersten Jahr der Aufnahme in den Leistungskatalog grundsätzlich der Preis vergütet werden muss, den der Hersteller zuvor festgelegt hat. Erst nach Ablauf dieses Jahres wird der Marktpreis durch einen zwischen GKV-Spitzenverband und Anbieter verhandelten Preis ersetzt. Angesichts dieser kritisch zu sehenden Regelung ist es wichtig, zügig ein Verfahren zu entwickeln, mit dem der monetäre Wert einer digitalen Anwendung möglichst objektiv ermittelt werden kann. Gleichzeitig sollte die im Gesetz vorgesehene Möglichkeit aufgegriffen werden, durch die Vereinbarung von Höchstbeträgen Mondpreise im ersten Jahr zu verhindern.
Zugriff auf Gesundheits-Apps
Unklar ist derzeit ebenfalls, auf welche Weise die Versicherten überhaupt Zugriff auf verordnete digitale Gesundheitsanwendungen erhalten. Die etablierten App-Stores von Apple und Google sieht das DVG nur als Ausnahme vor. Die Einrichtung eines autonomen, auf die deutsche GKV zugeschnittenen Vertriebsweges erscheint jedoch aus verschiedenen Gründen unrealistisch. Bedeutet das also, dass die Apps zunächst durch den Versicherten gekauft und der Preis anschließend durch die Krankenkasse zurückerstattet wird? Dabei würden 30 Prozent als Provision direkt an den Betreiber des App-Stores fließen. Alternativ könnte der Versicherte nach Einreichung der ärztlichen Verordnung einen Freischaltcode erhalten, mit der er die App nutzen kann, ohne finanziell in Vorleistung zu gehen. Welche Wege hier zukünftig möglich – und sinnvoll – sind, wird derzeit diskutiert.
Angesichts der Berichterstattung der letzten Monate um mögliche Sicherheitslücken bei Gesundheits-Apps muss auch die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben Teil des Bewertungsverfahrens sein. Dabei geht es auf keinen Fall darum, Datenschutz als Totschlagargument zu verwenden. Bestimmte Datenflüsse können notwendig sein, um Anwendungen zu verbessern und damit auch den Versicherten eine hohe Usability (Nutzungsqualität) zu bieten. Gleichzeitig muss jedoch sichergestellt sein, dass hierbei keine medizinischen Informationen übermittelt und keine personenbezogenen Daten an Dritte gesendet werden. Es ist zu hoffen, dass die Anbieter von Gesundheitsanwendungen eine hohe Sensibilität zeigen und das BfArM in der Lage ist, notwendige Prüfungen auch regelmäßig durchzuführen. Nur so können mögliche Vorbehalte gegen neue digitale Versorgungsansätze abgebaut werden.
Eine wichtige Rolle dabei kommt auch den Krankenkassen zu. Sie werden zukünftig bestehende Angebote zur Förderung der Gesundheitskompetenz gezielt auf den digitalen Bereich ausweiten. Gleichzeitig erhalten sie die Möglichkeit, ihren Versicherten auf ihren konkreten Bedarf zugeschnittene Versorgungskonzepte zu machen. Damit wird auch das große Angebot spezifischer Behandlungsangebote der Ersatzkassen für den einzelnen Versicherten noch übersichtlicher und ermöglicht – nach vorheriger Einwilligung – eine individuellere Betreuung.
Zweites Digitalgesetz in Vorbereitung
Um die regulatorischen Rahmenbedingungen für alle Aspekte der Digitalisierung zu schaffen, braucht es mehr als ein Gesetz. Bis Jahresende wird daher der Entwurf eines DVG II erwartet, das vor allem weitergehende Regelungen zu der zum 1. Januar 2021 startenden elektronischen Patientenakte (ePA) enthalten wird. Diese Regelungen wurden im Gesetzgebungsverfahren zum DVG zunächst abgetrennt, da weiterer Abstimmungsbedarf zu datenschutzrechtlichen Fragestellungen zwischen den einzelnen Bundesministerien bestand. Nun ist zu hoffen, dass mit dem DVG II der Umfang der ePA noch einmal deutlich erweitert wird. Denn nur mit einer Vielzahl relevanter medizinischer Informationen erhalten Leistungserbringer und Versicherte Transparenz über bisherige Untersuchungsergebnisse und Behandlungsschritte. So würden – wie auch mit dem gerade beschlossenen DVG – die Möglichkeiten und Chancen der Digitalisierung auf vernünftige Weise genutzt und die Ansätze für eine weitere Verbesserung der Versorgung geschaffen.





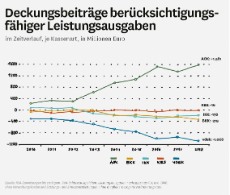









 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026
Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026
Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


