Die Corona-Pandemie hat weltweit eine Vielzahl bioethischer Konflikte hervorgerufen, etwa bei Impffragen und der Gesundheitskompetenz. Wie unterscheiden sich diese Konflikte von Land zu Land, und gibt es Gemeinsamkeiten? Auch die Corona-Warn-Apps werfen mit Blick auf die Kontaktverfolgung ethische Fragen auf. Medizinethikerin Prof. Dr. Silke Schicktanz von der Universität Göttingen forscht zu diesen Fragen und spricht mit ersatzkasse magazin. über die ethischen Dimensionen der Pandemie.

Frau Prof. Dr. Schicktanz, am Institut für Ethik und Geschichte der Medizin der Universitätsmedizin Göttingen beschäftigen Sie sich mit Bioethik. Wie sind Sie zu diesem Thema gekommen?
Prof. Dr. Silke Schicktanz: Der Grundstein für mein Interesse an Bioethik wurde in den 1990er Jahren gelegt, als ich Biologie und Philosophie an der Universität Tübingen studierte. Diese neue und damals noch ungewöhnliche Kombination habe ich als sehr spannend empfunden. Die Grundidee von Bioethik ist, fachübergreifendes Wissen von Geistes, Sozial‑ und Naturwissenschaften zusammenzubringen, um zu überlegen, welche sozialen oder ethischen Probleme sich durch die Entwicklung neuer Technologien ergeben. Denken wir dabei an die Debatte um das Klonen, die Früherkennung von Krankheiten – und natürlich die Corona-Pandemie.
Im Rahmen Ihres aktuellen Forschungsschwerpunktes beschäftigen Sie sich mit den pandemiebedingten globalen bioethischen Konflikten im Rahmen eines Ländervergleichs. Wie kam es dazu?
Mich interessieren gerade die neuen Themen in der Medizinentwicklung. Noch vor 20 Jahren wurden Infektionen im westeuropäischen Kontext aufgrund des medizinischen Fortschritts nicht als Bedrohung wahrgenommen. Während meiner Doktorarbeit habe ich mich schon mit dem Risiko beschäftigt, dass durch die Transplantation von tierischen Organen auf den Menschen – was ein neuer Ansatz war – Infektionen entstehen und sich als Pandemie weiterverbreiten könnten. Das hatten viele als eher unwahrscheinlich eingeschätzt. Das hat sich grundlegend geändert. Durch die vielen internationalen Kontakte, die aufgrund meines eigenen Forschungsschwerpunkts der internationalen Bioethik bestehen, ist daher die Idee entstanden, zu erforschen, wie bioethische Themen in verschiedenen Ländern diskutiert werden. Inzwischen haben wir in dem laufenden Projekt insgesamt 40 Interviews mit führenden Bioethikerinnen und Bioethikern auf allen Kontinenten geführt. Erste Auswertungen verdeutlichen die radikalen Unterschiede insbesondere zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden. In Entwicklungsund Schwellenländern mit einer schlechten öffentlichen gesundheitlichen Grundversorgung hatte die Pandemie bereits im Anfangsstadium fatale Folgen. In den westlichen Ländern wurde die Pandemie wegen der hohen Lebensstandards und der Robustheit der Gesundheitsversorgung eher unterschätzt.
Mit welchen Fragen beschäftigen Sie sich konkret?
Wenn man Pandemien bekämpfen will, muss man sie als globales Phänomen verstehen. Denn ein Virus lässt sich nicht durch Landesgrenzen aufhalten. Daher zeigen wir in globaler Perspektive auf, welche Maßnahmen sozial akzeptiert werden. Zudem spielen kulturelle Einflüsse auf den Umgang mit Pandemien eine Rolle. Gefragt wird beispielsweise, welche Rolle Vertrauen oder Misstrauen in die Politik spielen oder auch ob ein Grundverständnis von Wissenschaftlichkeit notwendig erscheint. Eine Gesundheitskrise wirkt quasi wie ein Brennglas auf politische Konflikte. Wenn das Grundvertrauen der Bevölkerung gegenüber politisch Handelnden gering ist, besteht ein höheres Risiko, die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zu ignorieren.
Können Sie aus Ihren ersten Ergebnissen schon ableiten, was wir aus dem Ländervergleich lernen können?
Es gibt nicht den einen Faktor und das macht es kompliziert. Was wir sicherlich lernen können, ist, dass unser derzeitiges Gesundheitssystem und die solidarfinanzierte Struktur ein großes Plus sind, weil Deutschland die Corona-Krise im Ländervergleich bislang insgesamt gut bewältigt hat. Es zeigt sich auch, dass Länder, die eine klare hierarchische Struktur im Gesundheitswesen besitzen, teilweise Vorteile haben, weil die Umsetzung von Maßnahmen schnell und einheitlich vonstattengeht
Inwieweit spielt auch die Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung eine Rolle?
Von den meisten der interviewten Expertinnen und Experten wird die Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung weltweit als viel zu gering eingeschätzt. Und darin sehe ich auch die wichtige Aufgabe für die Zukunft. Denn bei der Corona-Pandemie geht es um präventive Maßnahmen und ein Grundverständnis bei den Menschen, wie Erreger übertragen werden. Wenn es freiwillige Impfangebote gibt, müssen die Leute individuell kompetent sein, um die Risiken und Nutzen für sich abzuwägen. Aus meiner Sicht muss Gesundheitskompetenz daher sehr früh ansetzen – und auch Teil der allgemeinen Schulbildung werden.
Betrachten wir die wichtige Diskussion um das Thema Impfungen. Wie sehen Sie das in anderen Ländern? Impfungen haben auch mit Gesundheitskompetenz, mit Aufklärung und kulturellen Unterschieden zu tun. Warum liegt beispielsweise die Impfquote in Dänemark höher als in Deutschland? Was lässt sich in Zukunft besser machen, um das Verständnis für das Impfen zu fördern?
Zwei Stichwörter, die ich hier nennen möchte, sind Solidarität und Gemeinschaftssinn. Es zeigt sich, dass in demokratischen Ländern, die als Nation eine hohe kollektive Identität haben, die Bereitschaft zum Impfen höher ist. Dazu gehören Spanien, Dänemark, aber auch die skandinavischen Länder insgesamt. Bei der Impfung geht es dort nicht nur um Selbstschutz, sondern darum, die Gemeinschaft durch das eigene Verhalten schützen zu wollen. Die hohe kollektive Identität und Solidarität der dänischen Bevölkerung untereinander zeigt sich auch in anderen Studien, wenn es etwa um Forschungsbereitschaft oder Datenaustausch geht.
Ihr Ziel ist bei diesem Forschungsprojekt, ein globales Mapping zu erstellen. Soll das der Politik an die Hand gegeben werden, um zum Beispiel zukünftige Pandemien besser in den Griff zu bekommen, oder was ist das Ziel?
In erster Linie möchten wir einer breiten internationalen Gemeinschaft von Forschenden und Lehrenden die vergleichenden Ergebnisse und Materialien an die Hand geben. Natürlich haben wir nicht die eine richtige Lösung parat, vielmehr geht es um einen langfristigen Reflexionsprozess. Im nächsten Frühjahr werden wir in Zusammenarbeit mit einer Kunstwissenschaftlerin eine virtuelle Ausstellung im Internet eröffnen und freuen uns natürlich auch, wenn politische Entscheidungspersonen sich dafür interessieren. 20 Podcasts mit führenden Expertinnen und Experten wurden erstellt, die in die Webplattform in englischer Sprache eingebettet werden. Es geht darum, gute und schlechte Beispiele der Pandemiebewältigung aufzuzeigen, um daraus zu lernen und in den nächsten Jahrzehnten besser mit solchen Ereignissen umzugehen. Denn diese Pandemie wird nicht die letzte sein.
Im Kontext mit Corona erforschen Sie in einem weiteren aktuellen Forschungsvorhaben die Weiterentwicklung von Pandemie-Apps. Worum geht es konkret?
Die Beforschung von Pandemie-Apps ist Teil des Großprojektes COMPASS, das vom Bundesforschungsministerium gefördert wird und die Universitätskliniken in Deutschland untereinander vernetzt. In diesem Gesamtprojekt geht es darum, Pandemie- Apps und technische Plattformen zu optimieren, um in Zukunft besser zu simulieren, wie Pandemien sich ausbreiten und eindämmen lassen. Ein wichtiger Aspekt dabei sind ethische und soziale Fragestellungen, wenn es zum Beispiel um die soziale Akzeptanz solcher Apps geht.
Ausgangsbasis für Ihre Forschung sind die in Deutschland bereits vorhandenen Corona-Apps. Welche Bilanz ziehen Sie zu der Funktionsweise dieser Apps, auch in Abgrenzung zu anderen Ländern?
Bei der Einführung der Corona-Warn-App gab es spannende Diskussionen zum Datenschutz und zur Privatheit der Daten. Und die eingeführte Corona-Warn-App ist zumindest am Schluss gelobt worden – obwohl der Anfang sehr holprig war. Es ist ein schönes Beispiel dafür, dass durch die Auseinandersetzung zwischen Wissenschaft und Politik eigentlich ein gutes Modell entstanden ist. Indem die Corona- Warn-App mit hohen Datenschutzanforderungen verknüpft ist, hat sie eine große soziale Akzeptanz erreicht. Das wäre sicherlich nicht gelungen, wenn solche Corona-Apps GPS-Daten erfassen und an den Staat oder Sicherheitsorgane weiterleiten würden, wie es vor allem in autoritären Staaten der Fall ist. Es war aber früh klar, dass die Funktion der Corona-Warn-App unzureichend ist. Was bringt mir zum Beispiel das nach einem Supermarktbesuch in der App angezeigte Feedback, ein „mittleres Risiko“ zu haben? Muss ich mich jetzt testen lassen? An dieser Stelle ist die Corona-App nicht gut durchgedacht. Es mangelt an konkreten Handlungsempfehlungen. Das war sicherlich ein Konstruktionsfehler. In sehr kurzer Zeit wurde eine App produziert, ohne die Feedbacks sowie die Nutzenden, die diese Informationen bekommen, gründlich in den Blick zu nehmen.
Ist die Wissenschaft zu wenig in die Entwicklung der Pandemie-Apps einbezogen worden?
Außer den Zahlen, die kommuniziert wurden, nämlich wie viele Menschen die Corona-Warn-App heruntergeladen haben, ist bis heute unklar, was die App praktisch gebracht hat. Es wären beispielsweise Feedbackschleifen wichtig gewesen, um zumindest lokal zu zeigen, dass sich durch die App in der Stadt X ganz früh eine bestimmte Anzahl von Personen testen ließ und in Quarantäne ging. All das hätte durch eine gute Begleitforschung erreicht werden können, aber darauf wurde kaum ein Fokus gelegt. Das ist bedauerlich.
Sehen Sie denn in der Bevölkerung eine Bereitschaft dafür, forschungsgetriebene Apps, wie Sie sie sich vorstellen, zu nutzen?
Fragen wie diese haben wir im Rahmen einer aktuellen repräsentativen Umfrage in der deutschen Bevölkerung ab 18 Jahren gestellt. Danach haben 97 Prozent der Nutzenden von Smartphones grundsätzlich die Bereitschaft, Daten an die Forschung über eine Pandemie-App weiterzugeben. Die Verbreitung von Smartphones in der Bevölkerung liegt allerdings nicht bei 100 Prozent, sondern je nach Bevölkerungsschicht allenfalls bei 80 Prozent. Für die Beforschung mit Pandemie-Apps benötigen wir aber eine solch hohe Aktivitätsrate gar nicht. Selbst bei Aktivitätsraten von 20 bis 30 Prozent in der Bevölkerung bekommen Sie einen umfangreichen Datensatz, mit dem eine gute epidemiologische Forschung möglich ist. Und es lässt sich gut mit pseudonymisierten und anonymisierten Daten arbeiten.
Welche Daten könnten Sie durch neue Forschungs-Apps erheben?
Es kommt entscheidend darauf an, welche Daten die Leute bereit sind zu teilen. Es können Daten zum persönlichen Befinden sein, physiologische Parameter, Mobilitätsdaten, Kontaktdaten, aber auch soziale Daten, die darüber Auskunft geben, wie ein Mensch lebt, welchen Bildungsstand er hat, wie lang der Weg zur Arbeit ist und wo jemand arbeitet. Zurzeit haben wir zu wenige Informationen. Forschungsorientierte Apps könnten daher einen entscheidenden Unterschied machen.
Worin liegt denn der Mehrwert für die Nutzerinnen und Nutzer?
Es geht darum zu ergründen, welche Feedbacks die Menschen haben möchten. Um bei dem Beispiel eines in der Corona-App angezeigten mittleren Risikos in der Corona-App zu bleiben, könnten Empfehlungen folgen, einen Schnelltest durchzuführen oder in den nächsten drei Tagen auf mögliche Symptome zu achten. So könnten unter wissenschaftlicher Begleitung Handlungseskalationsstufen eingebaut werden. Wichtig ist auch, ein lernendes System zu implementieren, das sich immer wieder neu anpasst. Denkbar ist bei einer Forschungs-App auch, Forschungsergebnisse an die Nutzenden zurückzuspiegeln.
Sind Sie hoffnungsfroh, dass die Apps erweitert werden? Und glauben Sie – um auf das Thema Datenspende zu kommen –, dass die Menschen bereit sind, ihre Daten in den Bereichen, die Sie eben beschrieben haben, freizugeben und zu spenden?
Nach unseren Umfragen sind weit über 50 Prozent der Befragten bereit, Mobilitätsdaten und Kontaktdaten in einer erweiterten App an die Forschung weiterzugeben – und sogar Testergebnisse. Dies würden sie vor allem dann tun, wenn es sich um Apps von staatlichen Institutionen, von öffentlich finanzierten Instituten und den gesetzlichen Krankenkassen handelt. Dagegen gibt es eine allgemeine Skepsis, wenn private Firmen in die App-Entwicklung einbezogen werden. Zu groß ist die Sorge, dass die Daten für individualisierte Werbung oder andere Zwecke verwendet werden. Die öffentlichen Institutionen haben somit einen Vertrauensvorschuss, den sie in den nächsten Jahren auch nutzen sollten und nicht verspielen.
Auch wenn öffentlich finanzierte Einrichtungen als vertrauenswürdig eingestuft werden, gibt es Vorbehalte. So gab es Datenschutzprobleme im Zusammenhang mit wichtigen Projekten wie der elektronischen Patientenakte. Wie schätzen Sie das ein? Ist der Datenschutz ein Hemmschuh oder eine Grundvoraussetzung?
Die Grundidee des Datenschutzes ist absolut richtig und die öffentliche Skepsis, die wir haben, zeigt auch das Bedürfnis nach Datenschutz. Allerdings variiert bei konkreten Forschungsprojekten die Interpretation des Datenschutzes sehr stark. Hier gibt es gesetzlichen Nachbesserungsbedarf, weil die Datenschutz-Grundverordnung sehr viel Interpretationsspielraum bietet.
Im Zusammenhang mit der Datenspende für die Forschung fordern Sie auch „ethische Leitplanken“.
Wir brauchen ein ethisches Rahmenwerk, das detailliert regelt, für welche Zwecke die gesammelten Daten verwendet werden dürfen und wer die Einhaltung der Regeln kontrolliert. In der ethischen Debatte geht es um die Frage, ob es eine allgemeine, unspezifische Zustimmung der Nutzenden für die Verwendung ihrer Daten geben sollte, oder ob sich die Einwilligung nur auf bestimmte Forschungsprojekte beziehen sollte. Viele der von uns Befragten wären durchaus bereit, einer breiten Nutzung ihrer Daten zuzustimmen. Ich könnte mir daher eine offenere Form der Zustimmung für eine Datenspende vorstellen, vorausgesetzt, es werden wirksame Kontrollmechanismen eingeführt, die von eigens hierfür eingerichteten Gremien und Kommissionen überwacht werden.
Weitere Artikel aus ersatzkasse magazin. (6. Ausgabe 2021)
-
 Interview mit Prof. Dr. Silke Schicktanz
Interview mit Prof. Dr. Silke Schicktanz„Unser solidarfinanziertes Gesundheitssystem ist ein großes Plus bei der Pandemiebewältigung“
-
 Künstliche Intelligenz und Public Health
Künstliche Intelligenz und Public HealthDrei Fragen an Prof. Dr. Lothar H. Wieler und Dr. Katharina Ladewig





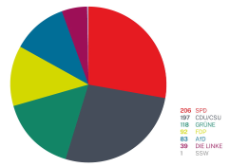


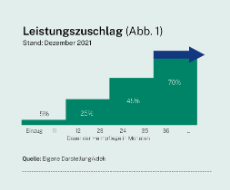







 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026
Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026
Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


