Am 1. Juli 2020 hat Deutschland unter dem Motto „Gemeinsam. Europa wieder stark machen.“ für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Die Bewältigung der Corona-Pandemie und die Stärkung der Reaktionsfähigkeit auf Gesundheitskrisen sind die Schwerpunkte im Bereich Gesundheit.
Ortwin Schulte leitet innerhalb der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der Europäischen Union (EU) das Referat Gesundheit. Im Interview mit ersatzkasse magazin. spricht er über die Zusammenarbeit auf europäischer Ebene und über gesundheitspolitische Ziele, die sowohl Deutschland als auch Europa insgesamt betreffen.

Herr Schulte, Sie leiten innerhalb der Ständigen Vertretung das Referat Gesundheit. Welche Aufgaben haben Sie in Brüssel? Und wie bringen Sie die Interessen Deutschlands in der EU unter?
Ortwin Schulte: Die Ständige Vertretung Deutschlands bei der EU ist die einzige Auslandsvertretung weltweit, in der alle Bundesministerien Verbindungsreferate unterhalten. Sie ist Ansprechpartnerin für die EU-Institutionen – vor allem natürlich für die Europäische Kommission und die Abgeordneten des Europäischen Parlamentes –, pflegt ein enges Netzwerk mit den Gesundheits-Attachés der anderen Mitgliedstaaten und berät das Heimatressort in EU-Verfahrensfragen und dabei auftretenden taktischen Aspekten. In der Sache bringt es das enge Netzwerk in Brüssel mit sich, dass von der Ständigen Vertretung oft auch eine Voraussage von Meinungstendenzen im Rat und ein Hinweis auf Kompromissmöglichkeiten erwartet werden.
Blicken wir zunächst auf die letzten Monate zurück. Welche Zwischenbilanz ziehen Sie zum Umgang der EU mit der Corona-Pandemie? Hat sich die EU dabei als Krisenmanagerin unter Beweis stellen können? Den Eindruck haben viele Bürgerinnen und Bürger wohl eher nicht gehabt.
Ich würde differenzieren: Mit der Pandemie kamen ab Februar 2020 grundlegend neue Fragestellungen auf die EU und ihre Mitgliedstaaten zu. Es wurden Freiheitsbeschränkungen erforderlich – etwa Grenzschließungen, Exportverbote und Ausgangssperren –, die vorher kaum vorstellbar waren. Grundlegende Sicherheitsrisiken verlangen nach schnellen staatlichen Antworten, die zunächst auf einzelstaatlicher Ebene angegangen wurden. Die Folge waren anfangs lange Staus an den Grenzen und unterbrochene Lieferketten. Allerdings ist aus der Krise und ihren praktischen Beschwernissen aus meiner Sicht relativ schnell gelernt worden. Es wurde in der akuten Krisenzeit grenzüberschreitend Hilfe geleistet und wir haben ambitionierte EU-Vorhaben etwa zur gemeinsamen Optionierung von Impfstoffen oder zur Erweiterung der Mandate der EU-Gesundheitsagenturen EMA und ECDC ins Auge gefasst. Ich denke, in diesen Projekten wird sich der Mehrwert der EU-Kooperation deutlich zeigen.
Birgt die Coronakrise auch die Chance beziehungsweise zeigt sie die Notwendigkeit auf, in Zukunft stärker untereinander zu kooperieren – nicht nur pandemiebezogen, sondern auch bei anderen Gesundheitsfragen?
Ich denke schon. Gesundheit war in der EU lange nicht das Hauptthema – auch deswegen, weil die EU-Mitgliedstaaten überwiegend großen Wert auf die autonome Steuerungsfähigkeit der Gesundheitssysteme legen. Aber die Krise hat die Handlungsnotwendigkeiten besonders hervorgehoben. Es wird darum gehen, gemeinsame neue Kooperationsbereiche mit klar erkennbarem europäischem Mehrwert zu erschließen, ohne den nationalen Handlungsspielraum zur Systemgestaltung grundlegend infrage zu stellen. Die Diversität der Gesundheitssysteme in den EU-Mitgliedstaaten ist Ausdruck starker Traditionen und unterschiedlicher Aufgabenverständnisse; dies sollte respektiert werden, ohne damit stärkere Kooperationen in ausgewählten Bereichen auszuschließen.
Für wie realistisch halten Sie die Idee, aus dem Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) ein europäisches Robert Koch-Institut entstehen zulassen? Welche Aufgaben hätte dieses?
Wenn andere eine traditionsreiche und renommierte deutsche Gesundheitsinstitution als mögliches Vorbild für eine reformierte EU-Gesundheitsschutzagentur bezeichnen, freut uns das natürlich. Aber wir sind nicht gut beraten, wenn wir selbst in Brüssel Deutschland als Vorbild bezeichnen. Zudem wäre zu beachten, dass es einige grundlegende Unterschiede in der rechtlichen Konstruktion und im möglicherweise neu zu definierenden Raum zugewiesener Entscheidungskompetenzen gibt. Aus Sicht der Brüsseler Praxis kann ich sagen, dass der fachliche Rat des ECDC in den EU-Institutionen außerordentlich geschätzt wird. Wir werden bald sehen, welche neuen Aufgaben und Ressourcen in der Zukunft zugewiesen werden.
Das Gesundheitssystem Deutschlands hat sich während der Pandemie vergleichsweise gut bewährt. Kann Deutschland generell eine Vorbildfunktion übernehmen?
Wir haben in Deutschland die Krise bisher gut überstanden, aber die Herausforderung ist noch nicht vorbei. Selbstverständlich ist es erlaubt, Vergleiche anzustellen und Schlussfolgerungen für die Zukunft zu ziehen, aber ein ungeschriebenes Brüsseler Gesetz lautet: Man sollte sich nicht selbst als Vorbild beschreiben und auch einen aufmerksamen Blick auf mögliche Vorzüge anderer Gesundheitssysteme behalten. Vielen erfolgreichen Strukturreformen in Deutschland ging ein intensiver Blick auf die Lösungen der EU-Partnerstaaten voraus – diese Neugier sollten wir uns bewahren.
Zum Thema EU-Ratspräsidentschaft: Seit Juli führt Deutschland den Vorsitz der EU-Ratspräsidentschaft. Europa soll stärker, gerechter und nachhaltiger werden – das ist das Ziel der Bundesregierung. Wie stark, gerecht und nachhaltig ist Europa derzeit?
Die Europäische Union befindet sich – nicht nur als Folge von Covid-19 – in einer fragilen globalen Situation. Sie ist sicherlich nicht perfekt, aber der derzeit am stärksten integrierte supranational angelegte zwischenstaatliche Verbund, der mit der strikten Bindung an Recht und Gesetz ein grundlegendes Prinzip verwirklicht. Nichts wäre besser, wenn wir die EU nicht hätten, insofern ist der Beitrag der EU-Politik zu Wohlstand, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit kaum zu überschätzen.
Im Juli wurde vom Europäischen Rat ein 1,8 Billionen Euro starkes EU-Haushalts- und Finanzpaket beschlossen. Das EU-Parlament hat aber noch Diskussionsbedarf. Ab September gehen die Verhandlungen los. Werden die Haushaltsverhandlungen dieses Mal besonders schwer? Und welche Rolle spielt dabei der Bereich Gesundheit?
Der Europäische Rat hat Mitte Juli 2020 ein wichtiges Zeichen gesetzt, indem neben der siebenjährigen Finanzplanung auch noch das Europäische Wiederaufbauinstrument beschlossen wurde. Erstmals darf die EU in größerem Stil Schulden aufnehmen, um Impulse für Wachstum, Nachhaltigkeit und Beschäftigung zu setzen. Natürlich waren diese Verhandlungen nicht einfach und es ist recht typisch, dass der Europäische Rat bei der Ausgestaltung etwas vorsichtiger und das Europäische Parlament etwas ambitionierter vorgehen. Es werden harte Diskussionen im Europäischen Parlament werden, die vielleicht auch den Gesundheitsetat erfassen werden, der beim Europäischen Rat ja deutlich gekürzt wurde. Für die einzelnen Politikbereiche ist aber klar, dass wir zu Summen nur in dem Umfang verhandeln, in dem die Vorgaben des Europäischen Rates dies erlauben.
Die EU-Kommission hat ein anspruchsvolles Arbeitsprogramm vorgelegt. Zudem fallen die Brexitverhandlungen in die EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands. Lässt sich das alles erfolgreich realisieren?
Der deutsche Ratsvorsitz 2020 hat in der Tat ein unvergleichlich dichtes Arbeitsprogramm, das unter teils widrigen äußeren Umständen umgesetzt werden muss. Der Brexit ist sicherlich eine zusätzliche Erschwerung, die sich niemand gewünscht hat. Die Erfahrung zeigt aber, dass die EU häufig dann am stärksten war, wenn der Krisendruck besonders ausgeprägt war.
Gegen Ende des Jahres soll auch eine Arzneimittelstrategie veröffentlicht werden. Worum geht es da genau und was soll sie bewirken? Wie schätzen Sie die Chancen ein, hier zu einem Kompromiss zu finden?
Die Arzneimittelstrategie ist zunächst ein für die Europäische Kommission handlungsleitendes Dokument, das die anstehenden Gesetzgebungsinitiativen ordnet und übergreifend begründet. Einiges – wie zum Beispiel die Frage der Anreizmechanismen für bestimmte Arzneimittelgruppen – ist bereits vor Covid-19 angelegt gewesen; andere Themen – wie beispielsweise das Thema Arzneimittellieferengpässe – sind durch die Krise noch sehr viel deutlicher als Problem erkannt worden. Wir freuen uns über die Entschlossenheit der Europäischen Kommission, dieses arbeitsintensive Dokument zu erstellen. Da wir im Arzneimittelbereich seit 1965 schon viel geschafft haben, bin ich optimistisch.
Covid-19 hat auch Ihre Arbeitsbedingungen ganz praktisch verändert. Distanz ist angesagt – und das in der arbeitsintensiven Zeit während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Was ist für Sie in diesen Zeiten die größte Herausforderung?
Die sprichwörtliche „Brussels Bubble“ funktioniert ganz wesentlich durch Ministerräte, Konferenzen, Ratsarbeitsgruppen, Seminare, Veranstaltungen und viele informell Gespräche auch bei zufälligen Treffen im EU-Viertel. Hier erfährt man durch Gespräche am Rande oft Dinge, die für die eigene Arbeit und für die Hauptstadt von großem Interesse sind. In Videokonferenzen gibt es diese informelle Dimension kaum. Ich freue mich deshalb persönlich sehr darüber, dass wir im deutschen Vorsitz zu einem erheblichen Teil zur Praxis physisch tagender Ratsarbeitsgruppen zurückkehren konnten – persönliche Treffen schaffen die Voraussetzung für eine besondere Verhandlungsdynamik. Trotzdem fehlen natürlich durch die Einschränkungen des Soziallebens viele andere Gelegenheiten zum persönlichen Austausch.
Weitere Artikel aus ersatzkasse magazin. 4. Ausgabe 2020
-
 Interview Ortwin Schulte (Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der Europäischen Union)
Interview Ortwin Schulte (Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der Europäischen Union)„In Krisenzeiten ist die EU besonders stark“















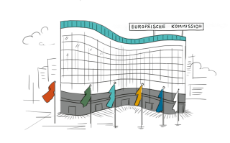

 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026
Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026
Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


