Klimawandel, Corona-Pandemie, Ukrainekrieg und Energiekrise haben große Auswirkungen auf das Gesundheitswesen. Die Politikerin und Medizinerin Dr. Kirsten Kappert-Gonther spricht im Interview über Strategien zur Bewältigung dieser globalen Krisen, die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) sowie die Notwendigkeit von Strukturreformen im ambulant-stationären Bereich.

Sie waren viele Jahre als Psychiaterin und Psychotherapeutin tätig. Was hat Sie dazu motiviert, den Weg in die Politik einzuschlagen?
Kirsten Kappert-Gonther: In die Politik zu gehen war für mich ein folgerichtiger Schritt, denn als Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie bin ich der Auffassung, dass sich Gesundheit im Alltag entwickelt. Und der Alltag ist durch politische Rahmenbedingungen geprägt, beispielsweise in den Bereichen Wohnen, Arbeit, Freizeit, Mobilität und Bildung. Mich beschäftigt vor allem die Frage, wie sich die Lebensbedingungen auf unsere Gesundheit und insbesondere auf die seelische Gesundheit auswirken. Als Gesundheitspolitikerin kümmere ich mich um dieses Thema und kann dabei von meiner über 25-jährigen ärztlichen Tätigkeit profitieren. Ich war zuerst in einer psychiatrischen Klinik tätig, dann in einem Reha-Institut für psychisch kranke Menschen, baute eine Institutsambulanz in Bremen auf und ließ mich dann mit einer eigenen psychotherapeutischen Praxis nieder. Diese praktischen Erfahrungen prägen meine politische Arbeit.
Wie hat sich Ihr Blick auf das Gesundheitswesen während Ihrer medizinischen Tätigkeit verändert?
Ich habe in jeder dieser Versorgungsstrukturen gern gearbeitet. Aber die vorhandenen Sektorbrüche und Informationsverluste sind nicht nur für die im Gesundheitswesen Tätigen, sondern gerade für die Patient:innen eine Bürde. Mein Interesse war daher schon länger darauf gerichtet, wie wir die Versorgung im Sinne der Versicherten bestmöglich weiterentwickeln können. Dass politisches Engagement in einer Partei tatsächlich Früchte tragen kann, hat mich nach meinem Beitritt bei Bündnis 90/Die Grünen vor über 20 Jahren weiter angetrieben – erst in der kommunalen Arbeit, dann in der Bremischen Bürgerschaft und schließlich in der Bundespolitik.
Ihre Partei hat gemeinsam mit SPD und FDP die Regierungsverantwortung inne. Wie haben Sie den Wechsel aus der Opposition in die Regierungsverantwortung wahrgenommen – auch im gesundheitspolitischen Bereich?
Die Verantwortung nehme ich als große Chance wahr. Im Rückblick bin ich aber überrascht, wie viel sich aus der Opposition heraus bewirken ließ, beispielsweise im Bereich Frauengesundheit, den ich in der vergangenen Legislaturperiode verantwortet hatte. Als regierungstragende Fraktion geht es darum, Kompromisse innerhalb der Koalition zu entwickeln. Im Gesundheitsausschuss beraten wir unter Hochdruck. Mein persönliches Anliegen ist, die seelische Gesundheit stärker in den Fokus zu rücken.
Derzeit sind Sie amtierende Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag. Wie schätzen Sie den Einfluss dieses Ausschusses ein?
Der Gesundheitsausschuss hat eine große Bedeutung, weil dort jedes Gesetz, jeder Änderungsantrag mit allen Parteien diskutiert wird. Kein gesundheitspolitisch relevanter Gesetzentwurf erreicht den Bundestag zur Beschlussfassung, bevor er nicht im Gesundheitsausschuss diskutiert wurde. An manchen Gesetzesvorhaben und Änderungsanträgen wird bis zur letzten Minute gefeilt. Je früher der Ausschuss die Vorlagen bekommt, desto fundierter kann über sie beraten werden.
Kooperieren die Parteien im Ausschuss gut miteinander?
Grundsätzlich ist die Kooperation gut – dies entspricht auch dem Wesen der Gesundheitspolitik. Denn wir ziehen in der Regel an einem Strang, da es darum geht, gemeinsam eine Gesundheitsversorgung zu gestalten, die für Patient:innen, Beschäftigte im Gesundheitswesen und Kostenträger:innen funktionieren muss. Viele im Gesundheitsausschuss Tätige kennen zudem die widersprüchlichen Interessenlagen, die um den politischen Rahmen herum gerade im Gesundheitsbereich eine Rolle spielen. Doch auch zwischen den Fraktionen gibt es große Unterschiede, beispielsweise zur Frage einer Bürgerversicherung.
Wie ordnen Sie die Gesundheitspolitik in den Gesamtkontext der Politik ein?
Als ich vor 15 Jahren damit angefangen habe, mich auf Gesundheitspolitik zu konzentrieren, galt das eher als Nischenthema, was ich schon immer nicht nachvollziehbar fand. Inzwischen hat sich das glücklicherweise geändert. Gesundheitspolitik bedeutet für mich, alle politischen Entscheidungen daraufhin zu überprüfen, welche Einflüsse sie auf Gesundheit haben. Wie bauen wir beispielsweise unsere Städte? Wie organisieren wir für unsere Kinder Kita und Schule? Das alles hat direkten Einfluss auf unsere Gesundheitschancen. Wer in Armut lebt, ist häufiger chronisch krank. Deswegen geht mit Sozialreformen wie dem Bürgergeld auch Gesundheitsförderung einher. Konkret brauchen wir sektorenübergreifende Versorgungsangebote vor Ort, einschließlich Angebote der psychosozialen Versorgung. Wir brauchen Orte, wo Berufsgruppen auf Augenhöhe zusammenarbeiten. In Deutschland gibt es noch immer eine sehr ärztlich dominierte Medizinprägung, die andere relevante Berufsgruppen im Gesundheitswesen zu Unrecht noch zu oft als Hilfsberufe wahrnimmt. Denn mit multiprofessionellen Teams könnten wir die Versorgung deutlich verbessern.
Durch die vorherrschenden Krisen wie die Klimakrise oder Coronapandemie ist das Gesundheitswesen auch mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert.
Ja, der Zusammenhang zwischen Klima und Gesundheit ist durch die extremen Wetterbedingungen und Ereignisse wie Überschwemmungen oder Hitze nun offensichtlich und erfahrbar für die Menschen geworden. Besonders betroffen sind vulnerable Gruppen, also Menschen, die in schlecht gedämmten Wohnungen leben oder draußen arbeiten. Klimaschutz ist Gesundheitsschutz! Eine große Herausforderung ist weiterhin die Coronapandemie. Sie hat uns in einem unfassbar rasanten Ausmaß vor Augen geführt, wie sehr wir alle individuell und kollektiv betroffen sind. Diese Virusentstehung ist auch in einem globalen Kontext zu betrachten. Wenn wir die Klimakrise nicht in den Griff bekommen, werden neue Pandemien wahrscheinlicher. Und auch hier gilt: Besonders betroffen davon sind die vulnerablen Gruppen – Kinder, alte und vorerkrankte Menschen. Wir sind ein reiches Land und arme Menschen haben ein signifikant höheres Risiko früher zu sterben als wohlhabende. Das kann nicht sein und ist eine große Herausforderung für unser Gesundheitswesen.
Die Bewältigung der verschiedenen Krisen, aktuell auch der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, kostet viel Geld. Geht das nicht auch zulasten des Gesundheitswesens? Wie werden da politisch die Prioritäten gesetzt?
Die Krisen machen deutlich, wie wichtig es ist, in Prävention zu investieren, denn sonst steigen die Kosten später umso mehr. Dass die Bundesregierung viel Geld zur Abfederung der Krisen einsetzt, ist richtig. Solidarität ist das Gebot der Stunde. Das geht nicht zulasten der Gesundheitspolitik. So werden nicht nur Bürger:innen und Betriebe von hohen Energiekosten entlastet, sondern mit rund acht Milliarden Euro auch die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Parallel besteht weiterhin die Herausforderung, die gesetzliche Krankenversicherung dauerhaft zu stabilisieren.
Kommen wir auf die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung zu sprechen. Wir haben jetzt ein Gesetz, das uns im nächsten Jahr über die Runden bringt – 2023 soll aber noch einmal neu diskutiert werden, wie es 2024 weitergeht. Ist das Gesetz zu kurzfristig angelegt?
In einem ersten Schritt wurden mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz die Lasten auf viele Schultern verteilt. Das Gesetz bringt uns aber nur kurzfristig „über die Runden“. Es liefert weder eine substanzielle Strukturreform, noch stellt es die Konsolidierung der GKV-Finanzierung sicher. Andererseits war es notwendig, schnell zu reagieren. Denn in den vergangenen Jahren gab es eine Reihe politischer Entscheidungen, die sehr teuer waren, ohne die Versorgung wirklich zu verbessern. Dieser enorme Schuldenberg – rund 17 Milliarden Euro – der gesetzlichen Krankenkassen hat sich letztlich als Folge einer gesundheitspolitischen Ausrichtung entwickelt, die sich statt echten Reformen des Füllhorns bedient hat. Von daher musste kurzfristig Stabilität her, um unser Solidarsystem nicht zu gefährden. Über die regelhafte Dynamisierung des Bundeszuschusses und die höhere Pauschale für gesetzlich versicherte ALG-II-Empfänger:innen wird weiter zu sprechen sein.
Die Ampelkoalition will auch Strukturreformen im ambulant-stationären Bereich auf den Weg bringen, Vernetzung fördern und die Versorgung auf dem Land sicherstellen.
Ja, wir brauchen eine Strukturreform, um die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung überall – in der Stadt und auf dem Land – zukunftsfest zu machen. Wir haben einen Fachkräftemangel bei Pflegekräften, zunehmend auch bei Ärzt:innen, Physiotherapeut:innen, Ergotherapeut: innen, Logopäd:innen und Hebammen. Der demografische Wandel führt indes zu einer Erhöhung der Krankheitslast bei gleichzeitiger Verknappung der Ressourcen. Vorhandenes Personal muss daher sinnvoll eingesetzt und Doppelstrukturen so gut wie möglich vermieden werden. Die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen müssen drastisch verbessert werden, nicht-ärztlichen Berufsgruppen muss mehr Verantwortung übertragen werden. Der ambulante und stationäre Bereich müssen auf regionaler Ebene besser vernetzt und perspektivisch gemeinsam geplant und vergütet werden. Bei den Krankenhausstandorten müssen wir zu mehr Zentralisierung kommen und das nicht in erster Linie aus finanziellen Gründen, sondern aus Gründen der Qualität der Versorgung. Wir müssen mehr Leistungen ambulant erbringen und hierfür interprofessionelle Angebote zum Beispiel in Primärversorgungszentren fördern. Dafür benötigen wir substanzielle Reformen, die verbindlich die Vernetzung ärztlicher, pflegerischer und therapeutischer Angebote regeln und die Aufgaben der verschiedenen Gesundheitsberufe neu justieren.
Was schwebt Ihnen da vor?
Ich erhoffe mir, dass etwa der Beruf der Community Health Nurses, wie er in Finnland existiert, auch in Deutschland zum Leben erweckt wird. Diese Pflegefachpersonen verfügen über eine hervorragende akademische Ausbildung und verantworten selbstständig Primärversorgungszentren in verschiedenen Regionen. Dorthin können sich die Menschen mit ihren gesundheitlichen Problemen ohne Anmeldung wenden. In einigen dieser Zentren bieten die Community Health Nurses zudem psychosoziale Krisenintervention an. Vielen der Betroffenen kann direkt geholfen werden, ohne dass sie eine Psychiaterin oder einen Psychotherapeuten brauchen. Dieses Beispiel zeigt, dass es neben den Problemen im Gesundheitswesen und dem großen Druck, unter dem die Krankenkassen und weitere Gesundheitsakteur:innen stehen, auch gute Chancen gibt, unsere Gesundheitsversorgung zu modernisieren.
Wie sollen diese Reformen finanziert werden?
Eine gute Gesundheitsversorgung gibt es nicht zum Nulltarif. Sicherlich gibt es bereits jetzt große Einsparpotenziale, ich denke da an die Notfallversorgung, die wir stärker durch ambulante Angebote entlasten müssen. Wenn wir aber beispielsweise beim Aufbau von Primärversorgungszentren ein neues Berufsbild wie die Community Health Nurses etablieren wollen, benötigen solche Strukturen erst einmal zusätzliches Geld. Das werden die gesetzlichen Krankenkassen natürlich nicht allein stemmen können. Bereits jetzt geben wir aber Steuermittel im substanziellen Umfang in die Gesundheitsversorgung. Dies ist zielführend, wenn die Rahmenbedingungen klarer gefasst sind. Die Potenziale guter, zielführender Prävention und Gesundheitsförderung sind noch nicht gehoben und würden im Verlauf zu Einsparungen führen. Und wenn wir Gesundheitsversorgung noch stärker vom Bedarf her denken, Doppelstrukturen meiden und Multiprofessionalität fördern, muss das langfristig nicht teurer werden – im Gegenteil. Klar ist aber auch, dass das Ziel jeder notwendigen Reform nicht primär Einsparungen sein dürfen, sondern es immer um die Verbesserung der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung geht.
Weitere Artikel aus ersatzkasse magazin. (6. Ausgabe 2022)
-
 Interview mit Dr. Kirsten Kappert-Gonther (Bündnis 90/Die Grünen), Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag
Interview mit Dr. Kirsten Kappert-Gonther (Bündnis 90/Die Grünen), Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag„Globale Krisen stellen uns vor große Herausforderungen im Gesundheitswesen“










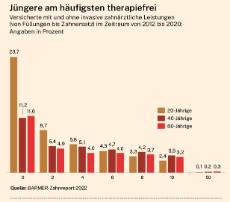

 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026
Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026
Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


