Derzeit erarbeitet das Bundesgesundheitsministerium zusammen mit den wichtigen Stakeholdern eine neue Digitalisierungsstrategie. Aus Sicht der Ersatzkassen müssen einige konkrete Maßnahmen umgesetzt werden, damit elektronische Patientenakten und E-Rezepte endlich in der Versorgung ankommen. Dabei muss auch das Verhältnis zwischen Datenschutz und Versorgungsverbesserung überdacht werden.

Das Bundesministerium für Gesundheit hat im Dezember 2022 einen Strategieprozess zur Digitalisierung in Gesundheit und Pflege gestartet. Im Rahmen von Veranstaltungen und Fachforen, an denen auch der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) und die Ersatzkassen beteiligt waren, sollten gemeinsam Ziele sowie Rahmenbedingungen definiert und Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung erarbeitet werden. Dass ein solcher Prozess erforderlich ist, überrascht zunächst. Schließlich ist die Digitalisierung des Gesundheitswesens nun schon seit zwei Jahrzehnten einer der Schwerpunkte der gesundheitspolitischen Diskussion.
Durch die Corona-Pandemie wurde deutlich, welches Potenzial telemedizinische Versorgungsangebote haben können: Im Jahr 2021 wurden allein im ärztlichen Bereich fast fünf Millionen Videosprechstunden abgerechnet. Viele Ärzt:innen, andere Leistungserbringende und Patient:innen zeigten sich offen, die zumeist recht einfach im Internet oder als App über private Endgeräte zugänglichen Videoangebote zu nutzen. Als Teil einer hybriden Behandlung werden Videosprechstunden sicherlich in den nächsten Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnen.
Nutzerfreundliches Videoidentifizierungs-Verfahren notwendig
Noch weitaus größeres Potenzial zur Verbesserung der Versorgung könnten elektronische Patientenakten (ePA) haben. Die Krankenkassen bieten sie ihren Versicherten seit 2021 an und zumindest in der Theorie wird ihr Funktionsumfang immer größer, zum Beispiel durch die Einführung der elektronischen Mutter- oder Impfpässe. In der (Arzt-)Praxis spielt die ePA allerdings aktuell fast keine Rolle. Bisher haben nur rund 550.000 Menschen eine Akte eingerichtet, also weniger als ein Prozent aller Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).
Tatsächlich ist der Weg zu einer Patientenakte derzeit recht aufwändig. Das liegt nicht an den Krankenkassen und den von ihnen beauftragten Anbieter:innen, sondern an den Vorgaben der IT-Sicherheit und des Datenschutzes. Mit dem Verbot der – relativ niedrigschwelligen – Videoidentifikation durch die gematik (Nationale Agentur für digitale Medizin) aufgrund möglicher Sicherheitslücken ist das Anmeldeverfahren zuletzt noch komplizierter geworden. Während also Bankkonten weiterhin per Videoident eröffnet werden können, kann die Identifizierung für die ePA-Anmeldung ausschließlich in einer Geschäftsstelle der Krankenkasse, der Postfiliale oder zum Teil mit der Online-Funktion des Personalausweises vorgenommen werden. Hier muss dringend Abhilfe geschaffen werden, damit ein weiterentwickeltes, aber nutzerfreundliches Videoidentifizierungs-Verfahren zügig online gehen kann.
Für den Fall, dass die Versicherten bis zu dieser Stelle noch nicht aufgegeben haben, kommt häufig die Ernüchterung in der Arztpraxis. Im gesamten Jahr 2021 wurden weniger als 10.000 elektronische Patientenakten erstmalig befüllt. Dies hat verschiedene Ursachen, wie beispielsweise eine fehlende oder komplizierte technische Umsetzung der ePA-Funktionalitäten in den Praxisverwaltungssystemen (PVS) oder auch eine eher geringe Digitalkompetenz bei Ärzt:innen und ihren Mitarbeiter:innen. Gleichzeitig sind viele sogenannte Medizinische Informationsobjekte (MIO), die die strukturierte Ablage von Informationen wie Laborbefunden oder dem Krankenhausentlassbrief ermöglichen, noch gar nicht abschließend entwickelt oder implementiert.
Doch letztendlich spielt es für die Versicherten keine Rolle, warum etwas nicht funktioniert. Auch für die sogenannten „Early Adopters“ bleibt die ePA bis auf Weiteres eine weitgehend leere Hülle, in die sie bestenfalls Befunde und andere Dokumente selbst einscannen und hochladen können. Um hier Abhilfe zu schaffen, braucht es schnelle und konkrete Lösungen:
- Die unterschiedlichen Arten medizinischer Informationen müssen klarer nach dem Versorgungsnutzen priorisiert werden. Gerade Entlassberichte, eine übersichtliche Patientenkurzakte sowie Befunde von Labor- und Röntgenuntersuchungen spielen im Alltag eine große Rolle und müssen unbedingt strukturiert in der ePA vorliegen. Sie sollten daher als MIOs zuerst realisiert werden. Der Entwicklungsprozess für MIOs, der aktuell unter Federführung der KBV stattfindet, muss außerdem effizienter werden.
- PVS-Systeme sollten nur dann in der Praxis eingesetzt werden dürfen, wenn sie alle ePA-Funktionalitäten unterstützen. Die Hersteller:innen müssen sicherstellen, dass MIOs direkt in ihren Systemen implementiert werden. Die Überführung von Daten in die ePA muss so einfach wie möglich, idealerweise auch automatisiert erfolgen. Auf diese Weise sinkt gleichzeitig der Aufwand in den Arztpraxen.
- Damit ist auch die Grundlage dafür geschaffen, Vertragsärzt:innen dazu zu verpflichten, die Informationen mit besonders hoher Relevanz für die Versorgung regelhaft in die ePA einzustellen. Die entsprechende Vergütung hat der Erweiterte Bewertungsausschuss bereits 2021 festgelegt.
Diese Maßnahmen entfalten genau dann ihre volle Wirkung, wenn das im Koalitionsvertrag vorgesehene „ePA-Optout- Verfahren“ auf pragmatische Weise umgesetzt wird. Das heißt, dass zum einen für alle Versicherten eine elektronische Patientenakte eingerichtet wird, soweit sie dem nicht widersprechen. Diese Widerspruchslösung sollte jedoch auch bei der Befüllung und beim Zugriff auf die gespeicherten Daten gelten. Damit hätte jede:r Leistungserbringende grundsätzlich die Möglichkeit, relevante Informationen einzustellen und im Behandlungskontext Daten abzurufen. Zudem können Versicherte im Bedarfsfall einer Speicherung oder einem Zugriff widersprechen, ohne dass enorme technische und bürokratische Hürden entstehen.
Auch bei der zweiten wichtigen Anwendung in der Telematikinfrastruktur (TI), dem E-Rezept, besteht noch Handlungsbedarf, was die Nutzerfreundlichkeit angeht: Zwar liegt die Zahl der eingelösten Verordnungen bei mittlerweile mehr als 550.000, allerdings davon der übergroße Teil nur im sogenannten „Ersatzverfahren“. In der Praxis heißt das: Der Rezeptvordruck in DIN A6-Größe wird durch ein Formular mit QR-Code in DIN A4-Größe ersetzt. Dabei hatten mehrere Ersatzkassen zusammen mit weiteren Partner:innen bis Ende 2021 ein volldigitales E-Rezept im Einsatz, das jedoch aufgrund des geplanten Einsatzes der TI-Anwendung eingestellt werden musste. Anstelle der Krankenkassen-Apps, die von Millionen von GKV-Versicherten regelmäßig genutzt werden, muss für das E-Rezept – wenn auf Papier verzichtet werden soll – eine eigene Anwendung der gematik heruntergeladen werden, die dann auch nur über Gesundheitskarte und persönliche Identifikationsnummer (PIN) oder andere Umwege genutzt werden kann. Kundenfreundlicher wäre eine Bündelung aller Angebote in der App der jeweiligen Krankenkasse.
Immerhin besteht nun Aussicht auf eine papierlose Perspektive: Wie in anderen europäischen Ländern könnte 2023 auch das Einlösen eines elektronischen Rezeptes einfach über das Einlesen der Gesundheitskarte in der Apotheke ermöglicht werden. Allerdings müssen zunächst Bedenken des Bundesdatenschutzbeauftragten und des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik ausgeräumt werden. Dabei sollte eine pragmatische Lösung im Mittelpunkt stehen, die Datensicherheit und unkomplizierte Nutzbarkeit miteinander verbindet. Denn es ist schlicht keinem der Beteiligten zu vermitteln, warum Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen Prozesse eher komplizierter macht anstelle sie zu vereinfachen.
So ist neben den Partner:innen der Selbstverwaltung bei der Weiterentwicklung digitaler Lösungen insbesondere der Gesetzgeber gefragt, um das Verhältnis zwischen Datenschutz und Versorgungsnutzen klarer zu definieren. Gesundheitsdaten müssen zweifellos geschützt werden. Übertriebene Vorgaben dürfen allerdings nicht dazu führen, dass digitale Prozesse verunmöglicht werden oder Versicherte sie nicht mehr verstehen oder anwenden können.
Alle Akteur:innen in die Pflicht nehmen
Insgesamt braucht es also keine völlig neue Strategie zur Digitalisierung. Stattdessen können die begonnenen Vorhaben durch gezielte Maßnahmen zum Erfolg geführt werden. Dabei müssen alle Akteur:innen – einschließlich der Industrie, aber auch der für Datenschutz und Datensicherheit zuständigen Institutionen – stärker in die Pflicht genommen werden. Sich dabei an den Versicherten und ihren Bedürfnissen zu orientieren, kann der einzig richtige Weg sein.
Weitere Artikel aus ersatzkasse magazin. (6. Ausgabe 2022)
-
 Interview mit Dr. Kirsten Kappert-Gonther (Bündnis 90/Die Grünen), Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag
Interview mit Dr. Kirsten Kappert-Gonther (Bündnis 90/Die Grünen), Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Bundestag„Globale Krisen stellen uns vor große Herausforderungen im Gesundheitswesen“










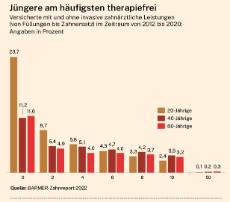

 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026
Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026
Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


