Das Bundesgesundheitsministerium hat ein NotfallGesetz angestoßen. Dr. Janosch Dahmen ist gesundheitspolitischer Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen und Notfallmediziner. Im Interview skizziert er die Probleme in der Notfallversorgung, erläutert geplante Maßnahmen sowie weiteren Änderungsbedarf und fordert einen stärkeren Fokus auf den Rettungsdienst.

Als Notfallmediziner setzen Sie sich stark für eine Reform der Notfallversorgung ein. Wie notwendig ist diese?
Dr. Janosch Dahmen: Es gibt seit vielen Jahren große Probleme in der Notfallversorgung. Das System ist sehr ineffizient, ein löchriger Flickenteppich schlecht abgestimmter und unübersichtlicher Hilfsangebote und eine im internationalen Vergleich zurückgefallene Qualität und Verlässlichkeit. Patientinnen und Patienten sowie das Personal leiden inzwischen unter der Gleichzeitigkeit von Unter-, Über- und Fehlversorgung. In allen drei Säulen der Notfallversorgung, also in den Notaufnahmen der Krankenhäuser, im vertragsärztlichen Notdienst und beim Rettungsdienst, gibt es einen seit Jahren bestehenden Reformstau. Bei den Notaufnahmen stehen wir vor der Herausforderung, dass diese aus zwei Gründen stark belastet sind. Erstens entsprechen die strukturellen Voraussetzungen, zum Beispiel die Größe und Aufteilung der Räumlichkeiten, aber auch die Fachqualifikation des Personals – beispielsweise Fachweiterbildung Notfallpflege oder Facharzt für Notfallmedizin – und auch die Ausstattung vielerorts nicht dem international aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft. Und zweitens ist es den Notaufnahmen aufgrund des immer stärkeren Arbeitskräftemangels auf den weiterversorgenden Stationen oft kaum möglich, Patientinnen und Patienten zeitnah aus der Notaufnahme weiter zu verlegen. Zudem stehen vielerorts nicht rund um die Uhr oder mindestens für die Stoßzeiten effiziente, ambulante Versorgungsstrukturen in den Notaufnahmen zur Verfügung, um fußläufige Akutpatientinnen und Akutpatienten bei weniger dringlichen oder komplexen Hilfebedürfnissen schneller und effizienter als komplexe Notfälle vor Ort versorgen zu können.
Letzteres betrifft die ambulante Notfallversorgung.
Problematisch ist, dass bei uns in Deutschland die Verlässlichkeit der Primärversorgung und auch der Langzeitpflege immer mehr erodiert. Auch die ambulante Notfallversorgung funktioniert nicht überall und nicht rund um die Uhr, so wie es medizinisch geboten wäre. Patientinnen und Patienten haben, wenn es ihnen plötzlich akut schlecht geht, außer dem Rettungsdienst oft keine vernünftigen alternativen Hilfsangebote. Diese Alternativlosigkeit setzt sich bei uns sogar leider in der Versorgungskette noch weiter fort: Auf den Rettungsdienst folgt die Notaufnahme und auf die Notaufnahme der stationäre Aufenthalt. In der Konsequenz werden also bei uns Menschen viel häufiger, als dies medizinisch sinnvoll und erforderlich wäre, in eine Notaufnahme gebracht und dann vom Krankenhaus zu kurzstationären Behandlungen aufgenommen. Dahinter stehen komplexe Fehlanreiz- und Fehlsteuerungsmechanismen, etwa dass die diagnostischen und therapeutischen Aufwände in der Notaufnahme mit den ambulanten Behandlungspauschalen gar nicht zu finanzieren sind und aus Abrechnungsgründen deshalb bei uns viel mehr Patientinnen und Patienten aufgenommen werden als in den europäischen Nachbarländern. Natürlich gab es schon einzelne erste Reformschritte in der Vergangenheit, etwa die Einführung der einheitlichen G-BA-Notfallstufen oder im Jahr 2012 die Einführung der bundeseinheitlichen Rufnummer 116117 für ambulante Akut- und Notfälle bei den Kassenärztlichen Vereinigungen (KV). Allerdings machen Menschen leider immer wieder die Erfahrung, dass sie nicht nur sehr lange in der Leitung warten müssen, sondern ihnen dann nicht fachgerecht geholfen werden kann und ihnen letztlich auch nur gesagt wird, dass sie doch besser direkt die Notfallaufnahme aufsuchen oder den Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112 anrufen sollen.
Mit dem Rettungsdienst wären wir bei der dritten Säule der Notfallversorgung.
Der Rettungsdienst ist oft das letzte Haltenetz in der Gesellschaft, er muss notgedrungen auffangen, was an anderer Stelle nicht richtig funktioniert. Wir haben bereits seit Jahren einen starken Anstieg der Einsatzzahlen und auch stationären Zuweisungen durch den Rettungsdienst. Das verschärft sich dadurch, dass durch die Notrufleitstellen der 112 vielerorts keine Ersteinschätzung durch eine standardisierte Notrufabfrage vorgenommen wird und auch keine technische und organisatorische Vernetzung mit der 116117 besteht. Patientinnen und Patienten können so medizinisch nicht sinnvoll gesteuert werden. Zum anderen stehen jenseits von Rettungswagen und Notarzteinsatzfahrzeugen keine weiteren alternativen Hilfsangebote systematisch rund um die Uhr zur Verfügung. Denken Sie an psychiatrische Nothilfe, Notfallpflege oder ambulante Palliativteams. All das wäre erforderlich, um Menschen in akuter Not fallabschließend ohne stationäre Behandlung am Notfallort vernünftiger helfen zu können und den Rettungsdienst zu entlasten.
Das NotfallGesetz soll Abhilfe schaffen. Eine Maßnahme ist der Aufbau sogenannter Integrierter Notfallzentren (INZ) an ausgewählten Krankenhäusern. Was steckt dahinter?
Mit einem INZ wird im Krankenhaus ein Ort geschaffen, in dem Menschen unabhängig von ihrem Hilfsbedürfnis die jeweils erforderliche Hilfe aus einer Hand erhalten. Sie werden an einem sogenannten Gemeinsamen Tresen ersteingeschätzt und dann in die für sie passende Versorgungsstruktur gesteuert. Dabei können komplexe oder dringliche medizinische Notfälle in der interdisziplinären Notaufnahme des INZ fallabschließend versorgt werden, weniger komplexe und weniger dringliche medizinische Notfälle analog in der integrierten KV-Notfallpraxis des INZ. Die Patientinnen und Patienten müssen so nicht vorher wissen, was genau sie brauchen, sie bekommen die für sie medizinisch sinnvolle Versorgung. Das ist nicht nur eine Entlastung für die Notaufnahmen, sondern auch eine erhebliche Vereinfachung für die Patientinnen und Patienten. Mit den INZ haben sie einen zentralen Anlaufort, an dem ihnen entweder stationär oder ambulant fach- und bedarfsgerecht geholfen wird.
Wie viele INZ sind nötig? Derzeit haben wir rund 1.700 Krankenhaus-Standorte.
Die Zahl der Standorte lässt sich jetzt noch nicht abschließend benennen, aber wahrscheinlich braucht es 500 bis 700 Stück für ganz Deutschland. Letztlich ist es sinnvoll, dass dies die Länder zusammen mit den Kostenträgern entscheiden. Natürlich ist in einem Stadtstaat mit kurzen Wegen eine andere Dichte an INZ bezogen auf die Bevölkerung erforderlich als in einem Flächenland, wo zwar wenige Menschen leben, aber auf großer Fläche mit weiten Strecken Notfallversorgung im engen Zusammenspiel mit dem Rettungsdienst anders organisiert werden muss. Es liegt aber auf der Hand, dass wir zukünftig deutlich weniger als die derzeit über 1.000 Notfallkrankenhäuser und wohl kaum eine ebenso große Zahl an Notfallpraxen brauchen. Es kommt darauf an, die Strukturen von bereits bestehenden Notfallpraxen und die Krankenhausstrukturen, insbesondere der umfassenden und erweiterten Notfallversorgung, zusammenzuführen. Dann schauen sich die Planungsbehörden der Länder an, was sinnvolle Standorte für die zukünftigen INZ sind, um eine gute Flächenversorgung und Erreichbarkeit für die Bevölkerung hinzubekommen.
Des Weiteren ist ein Ausbau der notdienstlichen Akutversorgung der KV mit einer 24/7-Bereitstellung vorgesehen. Wie lässt sich das umsetzen?
Wir müssen miteinander gesetzlich vereinbaren, was Sicherstellung in der ambulanten Notfallversorgung konkret bedeutet. Weiter irgendwie und überall anders wird nicht gehen. Wir müssen die Strukturen verbindlicher, einheitlicher und verlässlicher gestalten. Das bedeutet aber nicht, dass wir Ärztinnen und Ärzte aus den Praxen abziehen und stattdessen im INZ einsetzen wollen. Im Gegenteil, es braucht dringend mehr Multiprofessionalität in der ambulanten Notfallversorgung. Wir haben in Deutschland ein stark arztzentriertes System. Aber nicht alles, was in der ambulanten Notfallversorgung notwendig ist, muss von einer Ärztin oder einem Arzt gemacht werden. Das NotfallGesetz sieht deshalb etwa vor, dass für fahrende Bereitschaftsdienste künftig auch Gemeinde-Notfallsanitäterinnen und Gemeinde-Notfallsanitäter oder Community Nursing-Qualifikationen eingesetzt werden könnten. Das ist ein guter Schritt. In den Nachbarländern gibt es beeindruckende Systeme, wo mit Gesundheitsfachberufen vom Ultraschall bis hin zur Point-of-Care-Labordiagnostik komplexe ambulante Versorgung aus dem Fahrzeug heraus inklusive telemedizinischem Callback-Verfahren mit Ärztinnen und Ärzten in den Leitstellen vorgenommen werden. Telemedizinisch assistierte „Treat at home“-Konzepte, also dass das Krankenhaus und multiprofessionelle Strukturen der Notfallversorgung zu den Patientinnen und Patienten kommen und nicht umgekehrt, das ist hier für die Zukunft absehbar das Stichwort. Da müssen wir aufholen.
Sie sprechen die Telemedizin an. Welches Potenzial hat sie in der Notfallversorgung?
Sie birgt ein enormes Potenzial. Ein Beispiel aus eigener Erfahrung in der Ärztlichen Leitung des Rettungsdienstes in Berlin: Dort hat die KV irgendwann angefangen, auf der Notrufnummer 116117 telemedizinische KV-Beratungsärztinnen und -Beratungsärzte rund um die Uhr einzusetzen, mit der Folge, dass der Anteil der aufsuchenden Hausbesuche durch KV-Beratungsärztinnen und -Beratungsärzte um 70 Prozent gesenkt werden konnte. Das heißt, ein Großteil der Hilfeersuchen konnte fallabschließend telefonisch oder telemedizinisch durch KV-Beratungsärztinnen und -Beratungsärzte beantwortet werden. Und das ist sicher noch nicht das Ende der Fahnenstange. Das Potenzial zu mehr Effizienz ist hier riesig. Wahrscheinlich braucht es auch hier noch nicht mal immer zwingend eine Ärztin oder einen Arzt, sondern auch entsprechend geschulte Pflegekräfte können Menschen in vielen Fällen abschließend gut helfen. Voraussetzung ist ein systematisches Qualitätsmanagement, strenge Standardisierung und Evidenzbasierung dieser Hilfeleistungsstrukturen. Es ist also erforderlich, dass wir rund um die Uhr telemedizinische Beratung dort, wo sie nach standardisierter Ersteinschätzung geboten ist, anbieten und die Menschen auch direkt zu Notfall- oder Hausarztpraxen steuern oder im Idealfall fallabschließend direkt digital helfen. Auch an anderen Stellen ist noch Luft nach oben. Nehmen wir das E-Rezept: Wenn über die ärztliche Beratungsleistung hinaus eine medikamentöse Behandlung erforderlich ist, könnte das E-Rezept Patientinnen und Patienten direkt durch die 116117 geschickt werden. Die Instrumente dafür stehen theoretisch schon heute zur Verfügung. Es ist Zeit, dass wir mit all dem endlich systematisch und überall in Deutschland anfangen. Nicht die Patientinnen und Patienten sind schuld an einer immer weiter gewachsenen Inanspruchnahme der Notfallversorgung, sondern das zunehmend löchrige Netz der Primärversorgung und unsere schrecklich ineffizienten und schlecht abgestimmten und wenig standardisierten Strukturen.
Neben der Notrufnummer 116117 der KV gibt es die Notrufnummer 112 des Rettungsdienstes. Doch die Menschen können mit der Unterscheidung oft nichts anfangen. Das NotfallGesetz ermöglicht eine Zusammenlegung als gemeinsames Notfallleitsystem. Eine sinnvolle Verzahnung?
Unbedingt. Den Notfall definiert immer der betroffene Mensch oder sein Umfeld selbst, das System muss darauf die medizinisch passende Antwort reproduzierbar und verlässlich geben können. Die Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass sie, wenn es darauf ankommt, die richtige Hilfe erhalten, egal welche Nummer sie gerade in einer Ausnahmesituation gewählt haben. Der Idealfall in der Praxis wäre, wenn ich überall in Deutschland bei einem medizinischen Notfall den Notruf 112 anrufen könnte, dort dann standardisiert eine Ersteinschätzung vorgenommen würde und falls sich herausstellt, dass es ein weniger dringlicher Akutfall ist, der keine unmittelbare Hilfe durch den Rettungsdienst braucht, wohl aber durch die KV-Notfallversorgung weiter versorgt werden muss, dann das Notrufgespräch digital direkt an die 116117 weitergeleitet wird, inklusive der bereits gegebenen und erhobenen Informationen sowie Dringlichkeitseinschätzung. Dort sollte dann eine noch differenziertere Einschätzung sowie die Entscheidung erfolgen, welches passende Hilfsangebot – also beispielsweise, ob jemand zu mir kommen muss, ob ich einen Termin in einer Notfallpraxis brauche, ob eine telemedizinische Beratung reicht oder ob die Verordnung eines E-Rezepts oder einer Krankenfahrt erforderlich ist – zur Verfügung gestellt wird. Regional wird das teilweise bereits umgesetzt. In Berlin beispielsweise werden mithilfe einer solchen technisch standardisierten Schnittstelle weit über 100 Anrufe am Tag von der 112 an die 116117 gegeben. Auch umgekehrt, wenn auch weniger oft natürlich, also wenn sich herausstellt, dass etwas dringlicher und schwerwiegender ist, wird der Fall automatisch von der 116117 an die 112 zum Rettungsdienst weitergeleitet. Notfallmedizin ist hoch dynamisch und nie eine Einbahnstraße.
Wie realistisch ist es, dass es zu solchen Zusammenlegungen gerade in der Fläche kommt? Das NotfallGesetz sieht nur vor, dass dies auf Initiative der Rettungsleitstellen geschehen soll. Braucht es da nicht eine klare Vorschrift durch den Gesetzgeber?
Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ist begrenzt und ermöglicht keine gesetzliche Verpflichtung der Rettungsleitstellen zur Kooperation. Hier sind die Landesgesetzgeber gefordert, die eine solche Verpflichtung teilweise bereits in Novellen der Rettungsdienstgesetze umsetzen. Mit Blick auf die deutliche Entlastung für das Personal im Rettungsdienst und die höhere Versorgungsqualität der Patientinnen und Patienten ist die technische und organisatorische Vernetzung zwischen 112 und 116117 unabdingbar. Die Verpflichtung der 116117-Leitstellen zur Kooperation mit interessierten Rettungsleitstellen liegt im Bereich der Bundeskompetenz und wird im NotfallGesetz verbindlich geregelt.
Sie fordern, den Rettungsdienst im Sozialgesetzbuch V differenzierter zu regeln. Warum ist das so wichtig?
Tatsächlich ist es so, dass die bisherige gesetzliche Grundlage für den Rettungsdienst, die vor vielen Jahren unter anderen Umständen geschaffen wurde, nicht mehr das abbildet, was erforderlich ist. So steht beispielsweise formal in der aktuellen Gesetzgebung im SGB V keine Regelung, die es zulässt, dass Patientinnen und Patienten durch innovative Versorgungsmodelle wie Gemeinde-Notfallsanitäterinnen und Gemeinde-Notfallsanitäter vom Rettungsdienst fallabschließend zu Hause oder am Notfallort behandelt werden können und die Krankenkassen dafür immer die Kosten übernehmen. Das Gesetz sieht streng genommen nur vor, dass der Rettungsdienst die Patientinnen und Patienten im Rahmen einer sogenannten Annexleistung zu einem Klinikaufenthalt vom Notfallort zur eigentlichen Behandlung in ein Krankenhaus bringt. Das führt heute unter anderem zu der bekannten Überfüllung in den Notaufnahmen der Krankenhäuser und zu Fehlbelegungen. Wahrscheinlich geben wir so jedes Jahr bis zu drei Milliarden Euro für stationäre Behandlungen aus, die medizinisch sinnvoller, günstiger und für die Patientinnen und Patienten schonender direkt am Notfallort erledigt werden könnten.
Was müsste konkret geändert werden?
Das SGB V führt grundsätzlich auf, was ein Mensch in seiner Rolle als Versicherter für einen Anspruch gegenüber seiner Krankenkasse hat. Ein expliziter Anspruch auf Notfallbehandlung steht allerdings nicht drin, obwohl natürlich auch darauf Anspruch besteht, genauso wie beispielsweise auf Krankenhausbehandlung, Rehabilitation und Zahnbehandlung, was allesamt im SGB V einzeln ausgeführt wird. Im nächsten Schritt muss definiert werden, unter welchen Umständen die Krankenkasse welche Kosten des Leistungserbringers erstatten muss. Da wäre wichtig festzulegen, dass eine Krankenkasse nicht nur dann zahlt, wenn ein Versicherter in einem Notfall mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wird, sondern auch, wenn dieser beispielsweise fallabschließend telenotärztlich oder an bestimmte Qualitätsvoraussetzungen geknüpft am Notfallort behandelt wird. Damit hätten wir bundesweit eine Rechtsgrundlage, die es ermöglicht, Innovationen und zeitgemäße Notfallversorgung als Flächenversorgung anzubieten und zu refinanzieren.
Wie würde die Ausgestaltung von Qualitätsstandards erfolgen, zum Beispiel die Festlegung der Hilfsfrist? Diese wird ja zum Teil in den Ländern unterschiedlich definiert mit entsprechenden Konsequenzen für die Patientinnen und Patienten.
Das würde den Ländern weiterhin obliegen im Zuge ihrer Rettungsdienstgesetze. Wichtig ist, regionale und insbesondere medizinische Begebenheiten nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft zu berücksichtigen. Bei der Hilfsfrist, also die maximale Zeitspanne, innerhalb derer ein Rettungsdienst ab dem Notrufeingang am Einsatzort eintreffen muss, braucht es zukünftig stärker unterschiedliche Hilfsfristen für unterschiedliche medizinische Zustandsbilder. Mindestens in besonders kritischen Fällen muss dabei weniger allein das Eintreffen von Rettungsmitteln am Einsatzort als das Eintreffen der Patientin und des Patienten im nächsten geeigneten Krankenhaus für die Planung und das Qualitätsmanagement berücksichtigt werden. Aufseiten des Bundes könnte höchstens die Gewährleistung bestimmter Versorgungsstandards beschrieben werden, aber die Details der strukturellen Anpassungen und der konkreten Ausgestaltung und Ausstattung des einzelnen Rettungsdienstes sind in den Ländern besser aufgehoben.
Sie fordern auch ein kluges Zusammenspiel von Krankenhaus- und Notfallreform inklusive Rettungsdienst. Wie zuversichtlich sind Sie nach den Diskussionen der vergangenen Monate, dass ein solches Zusammenspiel gelingt? Allein die Debatte um die Krankenhausreform zeigt, wie schwierig ein Kompromiss zwischen Bund und Ländern ist. Und beim Rettungsdienst müssen ebenfalls dicke Bretter gebohrt werden.
Die Debatte zur Krankenhausreform hat gezeigt, dass Bund und Länder gemeinsam zu einer aus fachlicher Sicht dringend gebotenen Lösung kommen können, auch wenn der Weg dorthin nicht immer einfach war. Die Länder sehen auch in Bezug auf die Notfallreform den hohen Regelungsdruck. Ich bin mir sicher, dass wir auch im Bereich des Rettungsdienstes zu einer für alle Seiten unterstützungsfähigen Regelung kommen werden, die die Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt stellt und das Personal im Rettungsdienst entlastet. Patientinnen und Patienten leiden genau wie das Personal unter den bestehenden Schwächen von Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Notfallversorgung, deshalb besteht dringender Handlungsbedarf auf allen staatlichen Ebenen zur Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Falle eines Notfalls und des hinreichend verlässlichen Schutzes von Leib, Leben und Gesundheit.
Weitere Artikel aus ersatzkasse magazin. (5. Ausgabe 2024)
-
 Interview mit Peter Weiß, Bundeswahlbeauftragter für die Sozialversicherungswahlen
Interview mit Peter Weiß, Bundeswahlbeauftragter für die Sozialversicherungswahlen„Spielräume der Selbstverwaltungen achten“
-
 Interview mit Dr. Janosch Dahmen, gesundheitspolitischer Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen
Interview mit Dr. Janosch Dahmen, gesundheitspolitischer Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen„Wir müssen die strukturelle Ineffizienz des Systems verändern“
-
 Interview mit Dr. Christian Fohringer, Co-Geschäftsführer von Notruf Niederösterreich
Interview mit Dr. Christian Fohringer, Co-Geschäftsführer von Notruf Niederösterreich„Nicht die gewählte Nummer darf entscheiden“










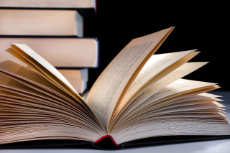
 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026
Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026
Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


