Seit Beginn dieses Jahres führt Niedersachsen den Vorsitz der Gesundheitsministerkonferenz (GMK). Im Interview spricht Dr. Andreas Philippi, niedersächsischer Minister für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung, über die Schwerpunkte seiner Amtszeit, den langen Weg der Krankenhausreform und die finanzielle Situation der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).
Welche Akzente möchten Sie in Ihrer einjährigen Amtszeit als GMK-Vorsitzender setzen?
Dr. Andreas Philippi: Es gibt einige Aspekte, die mir wichtig sind. Dazu gehört die Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, kurz ÖGD. 2020 wurde beschlossen, dass dieser mehr Mitarbeiter bekommen, modernisiert und vernetzt werden soll, zudem übernimmt er eine soziale Funktion. Dafür stellen Bund und EU bis 2026 insgesamt 4 Milliarden Euro bereit. Aber der Bund darf sich nächstes Jahr nicht komplett rausziehen. Wir können es uns nicht leisten, auf Situationen wie die Pandemie erst dann zu reagieren, wenn es zu spät ist. Einen zweiten Fokus lege ich auf die zivile Verteidigung und ein vollumfängliches Krisenmanagement. Aus diesem Grund haben wir die NATO zu unserer GMK-Sitzung im Sommer eingeladen und wollen mit ihr über Resilienz sprechen. Drittens liegt ein Schwerpunkt auf der Digitalisierung. Sie ist eine der großen Unterarmstützen, um das Gesundheitssystem gut steuern und Entlastung erzielen zu können und ist gerade auch in Flächenländern wie Niedersachsen wichtig, die beispielsweise teilweise Probleme mit der Akutversorgung von Schlaganfällen haben. Derzeit wird ein Modell erprobt, das einen Rettungswagen mit einem integriertem Computertomographen vorhält, sodass CT-Bilder direkt an Spezialisten übermittelt werden können und somit eine frühere Diagnose und Behandlung ermöglicht werden. Das spielt bei Fahrzeiten von 30 bis 90 Minuten zur nächsten Klinik eine erhebliche Rolle.
Derzeit wird intensiv über die Einführung eines Primärversorgungssystems diskutiert. Wie wichtig ist Ihnen das?
Das Primärarztsystem ist für uns eine zentrale Forderung. Wir glauben, dass es dazu beiträgt, Patientinnen und Patienten frühzeitiger anzusprechen, besser zu steuern, die Ressourcen effizienter zu nutzen und die Ärzte zu entlasten, wenn die Allgemeinmediziner als Weichensteller fungieren. Das schließt ein, dass die Ärztinnen und Ärzte weniger Bürokratie ausgesetzt sind, dafür mehr Zeit für die Patientinnen und Patienten haben. Und auch hier ist die Digitalisierung wieder relevant. Mir ist wichtig, dass wir als Länder jetzt Druck machen, damit schnell ein entsprechender Gesetzentwurf auf dem Tisch liegt. Die primäre Arbeit muss im Bundesgesundheitsministerium geleistet werden, aber wir Länder stehen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Uns ist klar, dass es teilweise unterschiedliche Haltungen etwa bei den Fachärzten gibt. Und es wird sicherlich an der ein oder anderen Stelle noch einige Verwerfungen geben. Doch ich wünsche mir nichts sehnlicher, und da bin ich auch zuversichtlich, als dass man sich auf das Wesentliche geeinigt hat, bevor es in den Prozess geht.
Ein Themenfeld, wo die Länder heftig mitreden, ist die Krankenhausreform. Den Ländern wird vorgeworfen, wichtige Ziele der ursprünglichen Reform immer weiter zu verwässern.
Ich verstehe, was gemeint ist, wenn es heißt, die Reform wird aufgeweicht. Aber man muss sich in die Situation der Bundesländer versetzen. Der Föderalismus hat nun mal vorgesehen, dass die Krankenhausplanung auf Länderebene gemacht wird. Und wenn wir jetzt, etwas zugespitzt formuliert, mit Härte gegen die Krankenhäuser vorgehen, was Qualität und Mengen angeht, dann hätten viele Krankenhäuser keine Chance zu überleben. Wir müssen eine Abwägung finden zwischen dem, was an Qualität machbar ist und was zumutbar ist. Und wir müssen auch als Länder untereinander unsere Einzelinteressen unter einen Hut bekommen und das bedeutet, Kompromisse zu finden. Das gilt genauso mit Blick auf den Bund, da kam es ebenfalls zu erheblichen Verhärtungen. Wir dürfen uns nicht durch viele Argumente neutralisieren, sondern müssen kompromissfähig sein.
Aktuell reden wir über das Krankenhausreformanpassungsgesetz (KHAG), das erneut Anpassungen unter anderem bei Qualität, Standortdefinition und Finanzierungsregelungen erfährt. Und wieder streiten sich Bund und Länder. Sie haben einen Kompromissvorschlag eingebracht, um die Anrufung des Vermittlungsausschusses zu vermeiden. Worum geht es Ihnen?
Wir versuchen derzeit, eine gemeinsame Position mit dem Bund zu entwickeln. Dafür haben wir vier wesentliche Punkte abgestimmt, von denen wir glauben, dass sie gut als Vorverhandlung dienen und wir so den Vermittlungsausschuss verhindern und das Inkrafttreten des Gesetzes beschleunigen können. Das betrifft etwa die Ausnahmegenehmigungen für die Qualitätsvorgaben in den Leistungsgruppen, hier brauchen die Länder mehr Beinfreiheit. Derzeit ist vorgesehen, dass wir maximal für drei Jahre im Einvernehmen mit den Krankenkassen Ausnahmen ermöglichen können. Wir erachten hier eine mehrmalige Erteilung der Ausnahmegenehmigung, etwa für zweimal drei Jahre, für erforderlich. Wir wollen planen und auch die Verantwortung tragen. Außerdem wollen wir schauen, wie wir das mit den Entfernungen geregelt kriegen. Bislang ist vorgesehen, dass mehrere Klinikgebäude nur dann als ein Krankenhausstandort ausgewiesen werden können, wenn diese nicht weiter als 2.000 Meter voneinander entfernt liegen. Wir fordern eine Erweiterung auf 5.000 Meter.
Wie wollen Sie Qualität unter solchen aufgeweichten Bedingungen sicherstellen?
Als Chirurg sage ich immer: Ob ich den Blinddarm in einem Grund- und Regelversorger operiert bekomme oder in einem Schwerpunktversorger oder in einem Maximalversorger, die Qualität der Blinddarmoperation muss überall gleich sein. Das ist durch Facharztkriterien auch gewährleistet. Nun sollen Leistungsgruppen eingeführt werden, für die Mindestanforderungen an die Qualität festgelegt werden. Aber natürlich lassen sich nicht alle Leistungsgruppen an jedem Ort jemals abbilden. Daher brauchen wir Kriterien für eine möglichst gerechte Ausgestaltung der Krankenhauslandschaft und müssen überlegen, was wir den Menschen zumuten können, etwa was Anfahrtszeiten betrifft. Man muss aber auch sehen: In Niedersachsen kann jeder in zehn Minuten in einer Endoprothetik versorgt werden. Zehn Minuten, das ist fast nichts. Das kann wiederum auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache sein.
Ein Kritikpunkt der Krankenkassen ist auch die nicht vorhandene Definition von Fachkrankenhäusern. Im Grunde könnte jedes Krankenhaus als Fachkrankenhaus ausgewiesen werden, das hat mit Konzentration, Bedarfsgerechtigkeit und Qualität wenig zu tun. Die Krankenkassen fordern eine bundesweite Definition vom Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA). Die Länder wollen, dass die Definition in Landeshoheit liegt. Warum sollte die Definition eines Fachkrankenhauses beispielsweise in Niedersachsen anders aussehen als in Bayern?
Weil sich die strukturellen Rahmenbedingungen der medizinischen Versorgung regional teils deutlich voneinander unterscheiden. Krankenhäuser in Stadtstaaten stehen vor anderen Herausforderungen als beispielsweise in Flächenländern wie Niedersachsen. Sollte die Regelung, so wie sie aktuell im Gesetzentwurf vorgesehen ist, tatsächlich kommen, würde dies für einige Landkreise eine regelrechte Schließungswelle bedeuten. Das kann nicht in unserem Interesse liegen.
Für den Umbau der Krankenhauslandschaft wird ein 50 Milliarden Euro schwerer Transformationsfonds aufgesetzt, finanziert zu gleichen Teilen von Bund und Ländern. Jetzt fordern Sie, dass die Länder Mittel aus dem Sondervermögen nach dem Länder und KommunalInfrastrukturfinanzierungsgesetz für die Kofinanzierung des Fonds nutzen können. Zudem fordern Sie, dass der Fonds nicht nur neue Strukturen fördert, sondern auch die Modernisierung bestehender Krankenhäuser. Führt dies nicht zu einer Zweckentfremdung des Fonds und einer Kompensation der unzureichenden Investitionsförderung der Länder?
Wir haben in Niedersachsen früh mit dem Transformationsprozess angefangen. Derzeit sind mehrere Zentralkliniken im Bau, die in wenigen Jahren weite Teile des ländlichen Raumes absichern werden. Es wäre in meinen Augen falsch, wenn die Bundesmittel nicht auch für diese Projekte aufgewendet werden dürften. Kliniken, die sich schon früh auf den Weg gemacht haben, ihre Strukturen anzupassen, sollten keine Nachteile haben gegenüber denjenigen, die es jetzt tun. Neben der Etablierung neuer Strukturen ist aber eben auch die Weiterentwicklung vorhandener versorgungsrechtlicher Strukturen zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit erforderlich, insbesondere in den ländlich geprägten Regionen. Daher muss der Transformationsfonds auch dort gelten, wo nur ein Krankenhaus zur Verfügung steht und wo Transformation nicht nur die Zusammenlegung ist, sondern auch Konzentration und Übergang von stationärer hin zu ambulanter Behandlung. Das betrifft in Niedersachsen etwa die Regionalen Gesundheitszentren, die als sektorübergreifende Versorger geeignete Alternativen für Regionen sein können, in denen der Betrieb eines Krankenhauses nicht mehr effizient genug ist.
Diese vier Forderungen treffen nun aber genau den Kern der Reform. Werden dadurch nicht die ursprünglichen Ziele der Reform zunichte gemacht?
An den ursprünglichen Zielen, also Qualitätssteigerung durch Konzentration, wollen wir nicht rütteln. Auch die Leistungsgruppen oder die Vorhaltevergütung stellen wir nicht infrage. Allerdings ist der Entwurf aus Sicht der Länder zu sehr von Berlin aus gedacht und berücksichtigt zu wenig die Anforderungen der Flächenländer. Eine Reform bringt wenig, wenn am Ende die medizinische Versorgung darunter leidet. Insofern geht es mir nicht darum, das Gesetz bis zur Unkenntlichkeit zu verwässern, sondern es an einzelnen Stellen gezielt zu optimieren.
In Deutschland gibt es derzeit rund 1.800 Krankenhäuser, in Niedersachsen sind es derzeit rund 160 Krankenhäuser. Wie viele Krankenhäuser werden durch Konzentration von der Krankenhauslandschaft wegfallen? Und glauben Sie, dass es durch die Krankenhausreform auch zu Einsparungen kommen wird?
Das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht seriös einschätzen. Vieles hängt davon ab, wie genau die Leistungsgruppen und Qualitätsvorgaben im KHAG geregelt werden. Aber erlauben Sie mir an dieser Stelle den Einschub, dass Konzen tration nicht unbedingt Schließung bedeutet. Im Heidekreis beispielsweise führen wir derzeit zwei kleinere Krankenhäuser zu einem Zentralklinikum zusammen. Das ist ein echter Gewinn für die Region. Ich verstehe es, wenn Menschen Sorgen haben. Aber die Fahrzeiten sind nicht allein ausschlaggebend für eine gute medizinische Versorgung. Es nützt nichts, ein Krankenhaus in unmittelbarer Nähe zu haben, welches dann jedoch bei bestimmten Leistungen kaum oder wenig Expertise vorweisen kann. Zugleich verbessert die Bündelung von Kompetenz die Wirtschaftlichkeit in den Kliniken. Viel entscheidender hierbei ist allerdings, dass Patientinnen und Patienten besser gesteuert werden. Deswegen setzen wir in Niedersachsen auf eine verstärkte Ambulantisierung. Den Menschen ist es am Ende des Tages prinzipiell egal, ob sie stationär oder ambulant abgerechnet werden. Die Hauptsache ist, dass die Behandlungsqualität stimmt.
Auch in Niedersachsen wurden schon Krankenhäuser geschlossen. Wie erklären Sie das der Bevölkerung?
Wir müssen auf die Menschen zugehen und ihnen klar machen, was wir mit der Krankenhausreform bezwecken und dass die Schließung eines Krankenhauses nicht eine Verschlechterung der Versorgung bedeutet. Denn es entstehen ja neue Häuser mit Schwerpunkten, wodurch wir eine bessere Qualität erzielen. Ich hatte es eben bereits erwähnt: In Niedersachsen bauen wir neue Zentralkrankenhäuser, während dafür andere Krankenhäuser vom Netz gehen. Aber dann konzentriert sich die Versorgung auf diese Zentralkrankenhäuser, die keinen Fachkräftemangel aufweisen und gut erreichbar sind. Möglicherweise wird es als Krankenhausschließung wahrgenommen, aber mein Narrativ ist, dass dafür Neues und Besseres entsteht, wir konzentrieren Leistungen. Genauso muss die Politik auch den Krankenhausträgern klar machen, dass sie neu denken, sektorenübergreifend arbeiten, Verbündete finden und Kompromisse eingehen müssen, sonst überleben sie als Krankenhaus nicht.
Zuletzt noch ein Blick auf die Finanzen: Die GKV verzeichnet enorme Ausgabensteigerungen. Eine FinanzKommission Gesundheit soll bis Ende März 2026 erste Maßnahmenvorschläge zur Stabilisierung der Beitragssätze ab 2027 vorlegen. Wie wollen Sie die Aufwärtsspirale stoppen?
Zunächst muss ich sagen: Es war ein großer Fehler der damaligen Bundesregierung, mit dem Versichertenentlastungsgesetz die gesetzlichen Krankenkassen dazu zu verpflichten, ihre Finanzreserven abzubauen. Dann müssten wir jetzt nicht darüber nachdenken, ob die Kassenbeiträge weiter steigen. Natürlich ist in den vergangenen Jahren vieles teurer geworden. Zugleich ist die Medizin mittlerweile auch viel individualisierter. Es gibt Medikamente und Therapien, die teilweise mit sehr hohen Kosten verbunden sind. Aber will man das den Menschen verwehren? Meiner Ansicht nach darf auch das Alter kein Kriterium dafür sein, ob jemand eine bestimmte Behandlung erhält oder nicht. Hier besteht viel Diskussionsbedarf. Es gibt natürlich auch Defizite struktureller Art. So kann man zum Beispiel darüber sprechen, wie mit den Freibeträgen für Angehörige umgegangen werden soll. Es ist ein schwieriger Spagat zwischen dem Ziel, dass es nicht teurer werden darf und dem Ziel, dass es nicht weniger Leistung geben darf. Hier erhoffe ich mir von der Kommission konkrete Vorschläge, allerdings nicht zulasten der Versorgungsqualität.






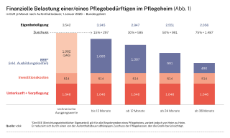






 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026
Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026
Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


