Elternsein macht glücklich. Doch offenbar geraten Mütter und Väter zunehmend unter Druck. Laut einer forsa-Umfrage im Auftrag der KKH Kaufmännische Krankenkasse fühlen sich aktuell 62 Prozent der Eltern mit minderjährigen Kindern häufig oder sogar sehr häufig gestresst. Genau zwei Drittel sagen darüber hinaus, der Stress habe in den vergangenen ein bis zwei Jahren zugenommen. Ein Grund sticht dabei besonders hervor.

Der Stresslevel steigt, die Folgen sind alarmierend: So zeigt die Umfrage, dass sich fast 70 Prozent der Eltern aufgrund hoher Belastungen mitunter erschöpft oder ausgebrannt fühlen. Fast 40 Prozent waren in stressigen Situationen schon einmal niedergedrückt oder depressiv. In einer ähnlichen Umfrage von 2019 lagen die Anteile mit 55 beziehungsweise 22 Prozent noch deutlich darunter. „Der große Anstieg ist ein Warnsignal. Wir müssen diese Entwicklung sehr ernst nehmen“, betont Dr. Aileen Könitz, Expertin für psychiatrische Fragen bei der KKH. „Dauerstress kann zu chronischer Erschöpfung, Depressionen und Angststörungen führen oder bestehende psychische Erkrankungen weiter verstärken.“
Doch was ist es, was Eltern so enorm unter Druck setzt? Laut aktueller Umfrage stehen an erster Stelle gesellschaftliche Themen wie die politische Lage, Klimawandel und Teuerung. Dies empfindet die Hälfte der Eltern als besonders stressig. Weitere Faktoren sind die Erziehung und Betreuung der Kinder (48 Prozent), die Arbeitsbelastung im Haushalt (46 Prozent) und die Angst um die Zukunft des Nachwuchses (44 Prozent). Mit etwas Abstand folgen die eigene Ausbildung oder der Beruf (37 Prozent) sowie Konflikte in der Familie (36 Prozent). Gut ein Viertel der Eltern belasten finanzielle Sorgen (29 Prozent).
Kinder zu haben und dabei einen gewissen Lebensstandard halten zu können, ist heutzutage sehr kostenintensiv. Deshalb sind häufig beide Eltern berufstätig. Die Arbeitsbelastung in Familien ist also immens. Gleichzeitig gibt es immer mehr Eltern, die den Berg an Aufgaben allein bewältigen müssen: In Deutschland leben laut Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend mehr als acht Millionen Familien mit minderjährigen Kindern. Davon sind 18 Prozent alleinerziehend. Meist tragen die Frauen die Hauptlast, denn in neun von zehn Fällen leben die Kinder bei der Mutter. Und das geht an die Substanz. „Frauen leiden häufiger als Männer an stressbedingten psychischen Krankheitsbildern wie Anpassungsstörungen und in der Folge auch an Depressionen. Das liegt aber nicht daran, dass sie seelisch instabiler sind. Sie sind oftmals stärker belastet“, erläutert Könitz.
Ständige Erreichbarkeit durch die Digitalisierung
Das Leben in einer dauerbeschleunigten, digitalisierten Gesellschaft birgt zusätzliches Stresspotenzial. Eltern verbringen inzwischen nicht nur selbst mehrere Stunden pro Tag mit dem Smartphone, sondern müssen ihre Kinder auch im Umgang mit Internet, Social Media & Co. begleiten. Und mit der Digitalisierung haben sich außer flexiblen Arbeitszeiten auch die ständige Erreichbarkeit und verschwimmende Grenzen zwischen Privat- und Berufsleben wie selbstverständlich etabliert.
Doch nicht jeder stuft bestimmte Situationen als gleichermaßen belastend ein. „Wann wir etwas als stressig empfinden und was, ist subjektiv und auch abhängig von der eigenen Resilienz und der Fähigkeit, mit Druck umzugehen“, so Könitz. „Fakt ist aber: Wer hohe Belastungen dauerhaft ignoriert, wird krank.“ Tückisch: Das Ausbrennen, der „Eltern-Burnout“, ist ein schleichender Prozess. Erste Anzeichen von Überforderung und Erschöpfung können Muskelverspannungen oder Schlafstörungen sein. Irgendwann fühlen sich betroffene Eltern völlig leer und antriebslos. Es schwinden Leistungsfähigkeit und Identifikation mit der Elternrolle. Mögliche Folgen: Vernachlässigung, schlimmstenfalls Gewalt.
Damit es gar nicht erst zu einem Burnout und zu psychischen Erkrankungen wie Depressionen kommt, sollten Mütter und Väter ihre Bedürfnisse frühzeitig hinterfragen und diesen auch genug Wichtigkeit einräumen. „Burnout-Prävention fängt also bei einem selbst an“, sagt Könitz. Bevor sich Betroffene professionelle Hilfe suchen, kann es zunächst hilfreich sein, das eigene Netzwerk zu beleuchten und zu überlegen, wer wie wann unterstützen kann. „Wichtig ist auch, die eigenen Ansprüche herunterzufahren und weniger perfektionistisch zu denken“, rät Könitz.
Weitere Artikel aus ersatzkasse magazin. (2. Ausgabe 2024)
-
 Interview mit Dr. Monika Lelgemann, unparteiisches Mitglied im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA)
Interview mit Dr. Monika Lelgemann, unparteiisches Mitglied im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA)„Entscheidungen sollten wohlüberlegt sein“
-
 Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz
GesundheitsversorgungsstärkungsgesetzVierte Version des GVSG wird zum Fördergesetz für die hausärztliche Versorgung






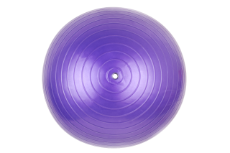






 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026
Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026
Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


