Sie hat jahrelang als Ärztin und klinische Epidemiologin gearbeitet und bringt heute ihre Expertise als unparteiisches Mitglied in den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) ein: Dr. Monika Lelgemann blickt im Interview auf die Rolle des G-BA im Gesundheitswesen, betont die Bedeutung interdisziplinärer Zusammenarbeit in der Versorgung und verweist auf den Nutzen evidenzbasierter Medizin.

Frau Dr. Lelgemann, Sie sind seit 2018 als unparteiisches Mitglied im G-BA. Was hat sie als Ärztin dazu bewogen, sich im G-BA zu engagieren?
Dr. Monika Lelgemann: Für dieses Amt vorgeschlagen wurde ich durch die gesetzlichen Krankenkassen. Ein wesentlicher Auslöser war möglicherweise meine Tätigkeit beim damaligen Medizinischen Dienst des Spitzenverbandes, bei dem ich die Abteilung Evidenzbasierte Medizin geleitet und den IGeL-Monitor mit aufgebaut habe. Die Erfahrungen, die ich in den verschiedenen Stationen meines Berufslebens sammeln konnte, nützen mir für meine Tätigkeit sehr. Führend war immer die systematische Aufbereitung medizinischen Wissens und die darauf basierende Entscheidungsfindung. Es scheint also fast so, als hätte ich mich immer auf die Stelle beim G-BA vorbereitet. Die interdisziplinäre Zusammensetzung der drei unparteiischen Mitglieder des G-BA ist ein großer Vorteil. Medizinischer, juristischer und politischer Sachverstand sind vertreten.
Welche Bedeutung hat der G-BA im Gesundheitssystem?
Ich schreibe dem G-BA einen hohen Stellenwert zu und halte unser solidarisch finanziertes Gesundheitssystem für ein schützenwertes Gut. Dabei erlebe ich den G-BA in den derzeit ja doch aufgeregten politischen Diskussionen als verlässlichen, transparenten und bedachten Entscheider. Man wirft uns teilweise eine gewisse Behäbigkeit vor, aber dieses umsichtige Vorgehen hat durchaus positive Effekte. Es gibt Entscheidungen, die sollten wohl überlegt sein. Dass wir kontinuierlich prüfen, in welchen Bereichen wir effizienter werden können, ist selbstverständlich. Der Fristenbericht, den der G-BA regelmäßig an den Bundestag übermittelt, zeigt, dass wir hierbei erfolgreich sind. Dennoch gibt es Abläufe, mit denen wir selbst unzufrieden sind. In der Regel sind das Bereiche, in denen wir durch einen Dschungel kleinteiliger gesetzlicher Vorgaben quasi ausgebremst sind. Beispiele sind die Studien zur Erprobung neuer nichtmedikamentöser Interventionen sowohl im stationären als auch im ambulanten Sektor oder etwa die komplizierten Abfolgen der Bewertung von Früherkennungsmaßnahmen unter Einsatz ionisierender Strahlung durch unterschiedliche Institutionen, so etwa beim Mammographie- Screening oder bei der Lungenkrebs-Früherkennung mittels Niedrigdosis-CT. Der immer mal wieder aufkommende Vorwurf, der G-BA sei eine Innovationsbremse, ist meines Erachtens eine Mär.
Woran zeigt sich die so wichtige Transparenz des G-BA?
Auf unserer Webseite finden Sie nicht nur unsere Beschlüsse, sondern alle zur Entscheidungsfindung verwendeten Unterlagen inklusive der Wortprotokolle der Anhörungen, der zahlreichen Experteneinschätzungen und der Evidenzbewertungen, die das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen – das IQWiG – erstellt hat. Zudem ist der Abwägungsprozess der Entscheidung im Detail dargelegt. In Sachen Transparenz sind wir also vorbildlich.
Im G-BA treffen zum Teil unterschiedliche Interessen aufeinander. Wie gehen Sie damit um?
Unsere Kernaufgabe ist der Interessensausgleich. Neben den vier Trägerorganisationen – GKV-Spitzenverband, Kassenärztliche Bundesvereinigung, Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung und Deutsche Krankenhausgesellschaft – spielen insbesondere die Vertreterinnen und Vertreter der Patientenorganisationen eine wichtige Rolle. Sie sind in allen Gremien des G-BA beteiligt, prägen die Diskussionen auf Augenhöhe mit und bringen Themen in die Beratungen ein. Zusätzlich zu den systematisch aufbereiteten Daten sind wir selbstverständlich auf fachlichen Input der Wissenschaft und der medizinischen Fachwelt angewiesen. Deren Einbeziehung erfolgt durch umfangreiche Einschätzungs- und Stellungnahmeverfahren, an denen auch nichtärztliche Organisationen, weitere Berufsgruppen und Hersteller beteiligt sind. Diese Einbeziehung ist für die sachgerechte Entscheidungsfindung des G-BA essenziell, wobei wir uns klar machen müssen, dass umfangreiche Beteiligungsrechte hohen Aufwand und gegebenenfalls Verzögerungen mit sich bringen können.
Eine Kritik ist, dass immer mehr neue Leistungen in den Leistungskatalog hinzukommen, die die alten aber nicht ersetzen.
Das stimmt, zumeist bleiben Leistungen erhalten. Es ist eine politische Entscheidung, die gesetzlich so angelegt ist. Der G-BA überprüft im Rahmen seiner Beobachtungspflicht kontinuierlich, ob seine Richtlinien dem Stand der Erkenntnisse entsprechen. Gibt es beispielsweise Hinweise darauf, dass der Nutzen einer bestehenden Leistung infrage zu stellen ist, gehen wir dem nach. Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet, nach dem neuesten Stand der medizinischen Erkenntnisse zu handeln. Insoweit kann man davon ausgehen, dass auf der Versorgungsebene die jeweils geeignete Intervention ausgewählt wird. Mit Blick auf neue nichtmedikamentöse Verfahren hielte ich es für sinnvoll, wie bei Medikamenten den Nachweis eines Zusatznutzens zu fordern. Insbesondere bei neuen Verfahren, die invasiver sind als die bisherigen, ist nicht einleuchtend, warum ein lediglich vergleichbarer Nutzen ausreichen sollte. Hierfür bräuchte es aber den gemeinsamen und den politischen Willen.
Der G-BA setzt sich auch dafür ein, dass Versorgungsmaßnahmen stärker der evidenzbasierten Medizin folgen. Was zeichnet evidenzbasierte Medizin aus?
Evidenzbasiert zu arbeiten, heißt für mich, dass wir anhand von Daten und Studien Entscheidungen treffen. Es geht darum, die zugrunde liegenden Erkenntnisse zu einer bestimmten Vorgehensweise oder Fragestellung systematisch aufzubereiten und transparent zu machen. Am Ende eines solchen Vorgehens steht nicht immer dieselbe Entscheidung, aber es gibt eine gleichförmig ermittelte Datenbasis, die der Ausgangspunkt für die darauffolgenden Entscheidungsprozesse ist. Evidenzbasierte Medizin hat viel mit Transparenz zu tun, auch in dem Sinne, Unsicherheiten sowohl in der Allokationsentscheidung als auch im direkten Kontakt mit den Patientinnen und Patienten zu kommunizieren. Unsicherheiten sind oft vorhanden, weil Datenlagen nicht immer eindeutig sind.
Wo kommt evidenzbasierte Medizin besonders zur Geltung?
Früherkennungsuntersuchungen sind hier auf jeden Fall zu nennen. Derzeit existiert ein Trend, möglichst noch mehr diagnostische Testverfahren, noch mehr Monitoring anzubieten. Das halte ich so singulär betrachtet für falsch. Denn es muss eigentlich auch immer darum gehen zu vermitteln, wie groß der mögliche Benefit ist, wie groß der mögliche Schaden und ob vielleicht eine Übertherapie erfolgt. Ein Beispiel: Ist es sinnvoll, bei einem 85-jährigen Patienten eine PSA-Wert- Bestimmung zu machen, um dann möglicherweise ein Prostatakarzinom zu erkennen, das nur langsam wächst und an dem er aller Wahrscheinlichkeit nach nicht sterben wird? Wir müssen versuchen, den Menschen klar zu machen, dass es darauf ankommt, sich zu überlegen, was die konkreten Folgen im Positiven und im Negativen sind. Die normale menschliche Reaktion ist doch die: Eigentlich wollen wir bei der Früherkennung nur bestätigt haben, dass alles in Ordnung ist. Aber das ist nicht der richtige Ansatz. Vielmehr müssen wir uns klar machen, dass Früherkennung nur Sinn ergibt, weil bei einem bestimmten Prozentsatz eben nicht alles in Ordnung ist.
Braucht es mehr Aufklärung bei der Früherkennung?
Vor allem Ärztinnen und Ärzte können im direkten Kontakt mit ihren Patientinnen und Patienten wesentlich dazu beitragen, den Nutzen und die Konsequenzen von Früherkennungsuntersuchungen verständlich zu machen. Aber auch die Krankenkassen spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, ihre Versicherten auf Früherkennung hinzuweisen. Für die Aufklärung zu sämtlichen Früherkennungsmaßnahmen stellt der G-BA umfangreiche, systematisch entwickelte und geprüfte Informationsmaterialien zur Verfügung. Hiermit soll die informierte Entscheidung der Versicherten gewährleistet werden. Wir würden uns wünschen, dass die Kassen stärker auf die bewerteten Früherkennungsprogramme und Informationsmaterialien setzen.
Welchen Stellenwert hat Früherkennung?
Früherkennung ist wichtig, aber wir müssen uns gut überlegen, was erbracht werden soll im Rahmen unseres Gesundheitssystems. Gerade vor dem Hintergrund begrenzter Ressourcen ist es fragwürdig, immer mehr Menschen ohne jegliche Symptome in die zum Teil bereits übervollen Arztpraxen zu lotsen. Zugleich vernachlässigen wir die Prävention. Das liegt nicht daran, dass wir nicht genug wissen. Wir wissen beispielsweise, dass sich die Lebenserwartung von Männern in Deutschland in Abhängigkeit von der sozioökonomischen Ausgangslage um acht Jahre unterscheidet, bei Frauen sind es vier Jahre. Das ist sehr viel. Genauso wissen wir, dass Kinder heutzutage unter Bewegungsmangel leiden, dass sie zunehmend Sprachentwicklungsstörungen haben, dass sie übergewichtig sind. Es fehlt nicht an Wissen, wir müssen einfach mehr tun.
Wen sehen Sie in der Pflicht?
Prävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das können weder die klassische Medizin noch die Krankenkassen alleine schultern. Sie muss auch vom Staat finanziert werden. Die Krankenversicherung kann nicht die Sporthalle bezahlen. Im Gegenteil: Um dieses gute gesetzliche Krankenversicherungssystem zu erhalten, sollten wir uns auf die Grundsätze besinnen. Es dient primär der Krankenbehandlung und sollte Maßnahmen enthalten, die einen nachgewiesenen Nutzen haben, zweckmäßig sind und das Maß des Notwendigen nicht überschreiten, so legt es das Sozialgesetzbuch fest. Und ich glaube auch, dass unser gutes Gesundheitssystem ebenso wie die Pflegeversicherung und das Rentenversicherungssystem wesentliche Stabilisierungsfaktoren sind für ein zunehmend schwieriges gutes Miteinander und sogar für den sozialen Frieden in diesem Land.
Sie scheiden in diesem Sommer auf eigenen Wunsch aus dem G-BA aus. Was geben Sie ihren Nachfolgerinnen und Nachfolgern mit auf den Weg?
Als ich hier angefangen habe, war ich überwältigt von der Qualifikation, der Motivation und Professionalität der Mitarbeitenden. Ihnen würde ich für die Zukunft manchmal etwas mehr Selbstbewusstsein wünschen. Grundsätzlich wären weniger hinderliche Vorschriften, weniger Bürokratie und ein bisschen mehr Mut zum Pragmatismus hilfreich.
Weitere Artikel aus ersatzkasse magazin. (2. Ausgabe 2024)
-
 Interview mit Dr. Monika Lelgemann, unparteiisches Mitglied im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA)
Interview mit Dr. Monika Lelgemann, unparteiisches Mitglied im Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA)„Entscheidungen sollten wohlüberlegt sein“
-
 Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz
GesundheitsversorgungsstärkungsgesetzVierte Version des GVSG wird zum Fördergesetz für die hausärztliche Versorgung






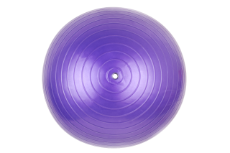






 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026
Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026
Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


