Das unabhängige Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) untersucht seit seiner Gründung 2004 Nutzen und Schaden von medizinischen Maßnahmen. Dr. Thomas Kaiser ist von Beginn an dabei gewesen, seit April dieses Jahres leitet er das IQWiG. Im Interview mit ersatzkasse magazin. spricht er über die Bedeutung von Evidenz und Forschung, den Umgang mit Studien und die Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung.

Herr Dr. Kaiser, wie haben sich Rolle und Aufgaben des IQWiG im Laufe der Jahre entwickelt?
Dr. Thomas Kaiser: Das IQWiG wurde mit dem Ziel gegründet, eine unabhängige Institution zu schaffen, die Evidenz bewertet und über Evidenz informiert. Dahinter stand die Frage, wie man mit den teilweise im System befindlichen Interventionen, aber auch neuen Arzneimitteln sowie anderen Untersuchungs- und Behandlungsverfahren umgeht. Gibt es Studien, die nachweisen, dass diese Therapien Vorteile gegenüber dem bisherigen Standard erbringen? Diese Zielsetzung verfolgen wir nach wie vor. Mein Anspruch ist allerdings, dass wir uns als IQWiG künftig noch frühzeitiger engagieren und bereits beim Aufsetzen von Studien, also bei der Generierung der notwendigen Evidenz, unsere Expertise verstärkt einbringen.
Was stetig wächst, ist unser Portfolio an Aufgaben beziehungsweise Bereichen, in denen wir Bewertungen durchführen. Das zeigt sich auch an der Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu Beginn hatten wir elf, inzwischen 284 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Am Anfang standen Arzneimittelbewertungen im Fokus und sie machen mengenmäßig betrachtet auch immer noch den größten Teil unserer Arbeit aus. Aber Nutzenbewertungen von nicht medikamentösen Verfahren stehen oft im Fokus des Interesses, etwa mit Blick auf den Einsatz von Medizinprodukten, Diagnostik oder Psychotherapien. Außerdem unterstützen wir mit unseren Evidenzberichten die Erstellung medizinischer Leitlinien. Diese Bereiche gewinnen an Bedeutung. Bei der Bewertung von digitalen Anwendungen, den DiGA, sind wir allerdings außen vor. Hier wäre es sinnvoll, ein Antragsverfahren beim Gemeinsamen Bundesausschuss zu etablieren und die Apps vom IQWiG bewerten zu lassen, so wie es auch für andere Medizinprodukte etabliert ist.
Derzeit läuft das Zulassungsverfahren über das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Reicht das nicht aus?
Das derzeitige Verfahren ist nicht annähernd so transparent wie das AMNOG-Verfahren für Arzneimittel und offensichtlich auch nicht so förderlich für die Entwicklung von DiGA, wie man sich das erhofft hat. Es macht schon Sinn, die Frage nach dem Einsatz medizinischer Leistungen weitgehend einheitlich anzugehen. Denn es geht ja bei einer solchen Bewertung um eine Verbesserung der Versorgung und damit immer um beide Richtungen: Leistungen ohne Nutzennachweis möglichst nicht ins System zu lassen, aber solche, die einen Fortschritt für die Patientinnen und Patienten darstellen, zu fördern.
Durch die Digitalisierung entstehen Massen an Daten. Wie wirkt sich Big Data auf Ihre Arbeit aus?
Große Datenräume und die Analyse dieser Daten sind ein wichtiger Aspekt für das ganze Feld der Evidenzgenerierung. Nicht nur die Datenmenge ist gewachsen, auch die Qualität der Datenerhebung ist zunehmend in den Fokus gerückt. Das erfordert eine kontinuierliche Entwicklung der Methoden, wie man Studien durchführt und auswertet.
Sehen Sie denn Entwicklungen bei den Studien, die Ihnen vorgelegt werden?
Ja, teilweise können wir durchaus positive Entwicklungen beobachten, etwa bei den von den Patientinnen und Patienten selbst berichteten Endpunkten. Lebensqualität und Symptome werden heute häufiger untersucht als das noch zu Beginn des AMNOG der Fall war. Was wir leider kaum sehen, ist eine Entwicklung bei der Durchführung von Studien für die Nutzenbewertung, wo der Frage nachgegangen wird, ob etwas Neues besser ist als etwas, das es schon gibt. Für die Hälfte der Verfahren liegen nach der Zulassung keine solchen vergleichenden Studien vor.
Woran liegt das?
Ein Pharmahersteller muss zwei Verfahren durchlaufen, wenn er in Deutschland ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel auf den Markt bringt. Da ist zunächst die Zulassung, um sein Mittel in Deutschland überhaupt verkaufen zu dürfen. Danach kommt die frühe Nutzenbewertung im Rahmen des Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes (AMNOG) aus dem Jahr 2011, womit ermittelt wird, wie hoch die Kostenübernahme durch die Krankenkassen nach dem ersten halben Jahr nach Marktzugang ausfällt. Für den Hersteller ist die Haupthürde die Zulassung, entsprechend richtet er ganz viel darauf aus. Die Frage, ob sein Medikament besser ist als ein bereits vorhandenes, ist für die Zulassung nicht relevant. Somit gibt es für den Hersteller auch wenig Anreiz, entsprechende vergleichende Studien durchzuführen.
Sollte das Zulassungsverfahren auf den Prüfstand?
Die Zulassung erfolgt über die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) beziehungsweise über das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) oder das Paul-Ehrlich-Institut (PEI), je nachdem, um was für ein Arzneimittel es sich handelt. Dabei geht es um die Frage, ob ein Arzneimittel mehr nutzt als schadet. Dieses Zulassungsverfahren als solches würde ich weniger kritisieren. Es gibt zwar Aspekte, die verbesserungswürdig sind, etwa wenn man auf Bereiche schaut, wo aus meiner Sicht selbst für die Zulassung die Datenlage so gering ist, dass man sich mit manchen Zulassungsentscheidungen sehr schwertut. Aber vom Prinzip her ist es richtig, zunächst generell die Wirksamkeit, Qualität und Unbedenklichkeit zu überprüfen.
Wie lautet dann Ihre Kritik?
Meine Kritik ist, dass nicht parallel zur Zulassung die Evidenz für die Versorgung geschaffen wird, also für die Frage, ob ein Medikament besser ist als das, was bereits auf dem Markt vorhanden ist. Dabei könnten wichtige Fragen beantwortet werden, ohne dass es gleich zu einer verzögerten Zulassung von solchen Medikamenten käme. Das Bewertungsverfahren zur Zulassung dauert im Durchschnitt gut ein Jahr. Parallel dazu könnten die Studien laufen, die vergleichende Ergebnisse liefern. Vereinzelnd wurde das auch schon gemacht. Beispielsweise hat ein Hersteller eines Lungenkrebsmedikaments parallel zum Zulassungsverfahren eine hochwertige vergleichende Studie gestartet, sodass bereits kurz nach der Zulassung die für die Versorgung relevanten Daten vorlagen. Vergleichende Studien parallel zum Zulassungsverfahren, das ist der Weg, zu dem wir kommen müssen. Allerdings sollten wir dafür auch Anreize schaffen. Entsprechend sollten Datenräume und eine Forschungsinfrastruktur bereitgestellt werden, auf die neben großen Pharmaunternehmen auch kleine und mittelständische Unternehmen sowie unabhängige Institutionen zur Durchführung solcher Studien regelhaft zurückzugreifen können.
In Deutschland wird ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz auf den Weg gebracht, die Europäische Union arbeitet an einem europäischen Gesundheitsdatenraum. Werden damit entsprechende Voraussetzungen geschaffen?
In dem kürzlich veröffentlichten Vorschlag zur Änderung des EU-Arzneimittelgesetzes sind tatsächlich Maßnahmen vorgesehen, die sich auf vergleichende Studien beziehen. Aber der europäische Gesundheitsdatenraum ist nicht darauf ausgerichtet. Es soll zwar ein Datenraum zur Verfügung gestellt werden, es wird aber nicht die Forschungsdateninfrastruktur ausreichend mitgedacht. Hier denkt man den Datenraum groß, aber die Forschungskapazität klein. Mehr Daten allein reichen nicht aus, man muss auch gute Forschung mit den Daten machen können. Daher muss die Forschung bereits beim Aufbau von Datenräumen mitgedacht werden. Wir brauchen eine Infrastruktur, die es ermöglicht, randomisierte Studien innerhalb eines Datenraumes, beispielsweise eines Registers, mit einer klaren Zielrichtung für die Versorgung durchführen zu können. So wird eine Vergleichbarkeit zwischen Studien geschaffen und für neue Arzneimittel klar herausgestellt, ob ein Zusatznutzen besteht oder nicht.
Arzneimitteln für die Behandlung seltener Erkrankungen, sogenannten Orphan Drugs, wird von Beginn an ein fiktiver Zusatznutzen unterstellt. Inwieweit ist das gerechtfertigt?
Die Orphan Drugs durchlaufen zwar anfangs auch eine AMNOG-Bewertung, aber betrachtet werden nur die Studien zur Zulassung, was qua Gesetz zwingend zu einem Zusatznutzen führt. Wir nennen dieses Verfahren daher eingeschränkte Nutzenbewertung. Die Argumentation für das Vorgehen ist, dass Menschen mit einer seltenen Erkrankung auf eine Therapie warten, die nicht verzögert zur Verfügung gestellt werden soll. Das ist aber nur dann ein sinnvolles Argument, wenn wir wissen, dass diese Therapie tatsächlich auch einen Fortschritt gegenüber den bisherigen zur Verfügung stehenden Therapien bringt. Hinzu kommt: Auf der einen Seite weiß man aufgrund des immer auszusprechenden Urteils eines Zusatznutzens nicht, ob das neue Arzneimittel tatsächlich einen Zusatznutzen hat. Auf der anderen Seite macht man dadurch alle Orphan Drugs gleich und kann diejenigen, die einen echten Fortschritt bringen, nicht hervorheben und prioritär einsetzen. Eine reguläre Nutzenbewertung findet zwar in manchen Fällen auch statt, aber erst nach Überschreitung einer Jahresumsatzgrenze. Diese lag zunächst bei 50 Millionen Euro und wurde mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz auf 30 Millionen Euro reduziert. Konkret wird etwa ein Drittel aller Orphan Drugs dadurch regulär bewertet, zwei Drittel also nicht.
Künftig sollen neue Arzneimittel auch auf europäischer Ebene einer Nutzenbewertung unterzogen werden. Wie wirkt sich das auf die Nutzenbewertung gemäß des AMNOG in Deutschland aus?
Der Vollausbau der europäischen Nutzenbewertung ist für 2030 geplant. Vorgesehen ist ein sogenanntes Rapporteur-System, bei dem ein Land hauptsächlich die Bewertung durchführt, ein anderes Land fungiert als Mitberichterstatter. Das IQWiG als Institution eines der großen EU-Länder wird eine führende Rolle bei der europäischen Nutzenbewertung einnehmen. Mit Blick auf Deutschland wird es sicherlich Änderungen insofern geben, dass es sinnvoll ist, Bewertungen in geringerem Maße durchzuführen, falls die Bewertung auf europäischer Ebene sehr gut zu gebrauchen ist. Ein deutsches Verfahren wird es aber trotzdem geben, auch weil die Bewertung auf europäischer Ebene ganz bewusst kein Urteil fällen soll hinsichtlich eines Zusatznutzens. Dafür sind die Versorgungsniveaus in den einzelnen Ländern zu unterschiedlich. Ebenso wird es auf europäischer Ebene kein so breites, öffentliches und deutschsprachiges Stellungnahme-Verfahren geben. Dass die Vorgänge und Bewertungen transparent und auf die deutsche Versorgungssituation ausgerichtet sind, ist aber eine wesentliche Komponente des AMNOG-Verfahrens.
Inwieweit hat sich das AMNOG bewährt, auch hinsichtlich der teilweise exorbitant hohen Kosten für Arzneimittel?
Wird im Rahmen der Nutzenbewertung eines Medikaments ein Zusatznutzen festgelegt, verhandelt der GKV-Spitzenverband mit dem Hersteller einen Erstattungsbetrag, der rückwirkend ab dem siebten Monat nach Verfahrensbeginn gilt. Arzneimittel ohne belegten Zusatznutzen werden im Preis gedeckelt oder einer Gruppe mit vergleichbaren Arzneimitteln zugordnet. Meiner Einschätzung nach hat dies schon dazu geführt, dass die Preisentwicklung gebremst wurde. Nach Berechnungen der DAK-Gesundheit spart das AMNOG den Krankenkassen mehrere Milliarden Euro pro Jahr. Das heißt aber nicht, dass die Preisentwicklung gestoppt wurde, sie wurde verlangsamt.
Was die Nutzenbewertung angeht, haben wir es wie bereits erwähnt leider nicht geschafft, die Quote der vergleichenden Studien zu verbessern. Wir wissen wie zu Beginn des AMNOG nach wie vor in der Hälfte der Fälle nicht, ob das Neue besser ist als das, was schon da ist. Schaut man sich die 20 umsatzstärksten Arzneimittel an, findet sich durchaus eine relevante Menge an Arzneimitteln mit Zusatznutzen, aber eben auch eine relevante Menge an Arzneimitteln ohne Zusatznutzen oder solche, die wir gar nicht bewertet haben, weil diese schon vor dem AMNOG in den Markt gekommen waren. Zudem gibt es Arzneimittel, die in einzelnen Bereichen einen Zusatznutzen haben, in anderen Bereichen nicht. Wir können also für einen relevanten Teil des Einsatzes von Arzneimitteln eigentlich nicht wirklich beurteilen, ob es wert ist, das Geld für das Medikament auszugeben.
Wäre das Szenario denkbar, ein Medikament erst nach einer Nutzenbewertung auf dem Markt zuzulassen?
Dann sprechen wir von der Einführung einer vierten Hürde. Diesen Weg gehen wir in Deutschland derzeit ganz bewusst nicht. Der Verzicht auf diese vierte Hürde hat aus der Perspektive der Evidenzbewertung auch seinen Vorteil. So haben wir die Möglichkeiten, offen und ehrlich die Schlussfolgerung zu ziehen, dass ein Arzneimittel keinen Zusatznutzen hat. Ich bin nicht überzeugt davon, dass dies im Falle einer vierten Hürde so bliebe, eben weil man dann in manchen Fällen sehr stark argumentieren würde, dass wir eigentlich nicht darauf verzichten können, dieses Arzneimittel in die Versorgung zu bringen. Den Wert dieser transparenten Kommunikation sollte man nicht unterschätzen.
Stichwort Transparenz: Das IQWiG hat den gesetzlichen Auftrag, Gesundheitsinformationen für Patientinnen und Patienten bereitzustellen. Wo stehen Sie da? Und gelingt es, die Menschen zu erreichen?
Auf unserer Webseite www.gesundheitsinformation.de informieren wir über die Diagnose und Therapie der 300 häufigsten Krankheiten in Deutschland. Die Nutzung der Seite ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen auf jetzt mehr als fünf Millionen Zugriffe pro Monat. Ein Wesen bei den Gesundheitsinformationen ist, und daran wollen wir unbedingt festhalten, objektiv zu beschreiben, wie die Datenlage ist, ohne zum Beispiel vorzugeben, dass man etwa eine bestimmte Operation durchführen sollte. Dazu stellen wir unterstützende Werkzeuge zur Verfügung, zum Beispiel sogenannte Entscheidungshilfen, die in einfacher Sprache wesentliche Dinge einer Erkrankung aufbereiten, auch um eine geteilte Entscheidungsfindung zu unterstützen. Was wir allerdings sehen, ist, dass wir nur einen Teil der Bevölkerung erreichen, nämlich diejenigen, die sich aktiv über das Internet mit Gesundheitsinformationen auseinandersetzen. Daher müssen wir unbedingt weiter daran arbeiten, andere Zielgruppen zu erreichen, etwa bildungsfernere Gruppen oder Menschen, die kaum in Kontakt mit dem Internet stehen. Wir wollen künftig auch differenzierte Zugänge bereitstellen, beispielsweise über Instagram oder YouTube oder auch mittels Print-Materialien, die in den Arztpraxen und Apotheken ausliegen. Nicht zuletzt ist es wichtig, dass wir im ärztlichen Bereich bekannter werden, etwa indem wir wissenschaftliche, gut erfassbare Informationen bereitstellen, die für das Verordnungsverhalten eine Rolle spielen.
Weitere Artikel aus ersatzkasse magazin. (5. Ausgabe 2023)
-
 Interview mit Dr. Thomas Kaiser, Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)
Interview mit Dr. Thomas Kaiser, Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG)„Mehr Daten allein reichen nicht“





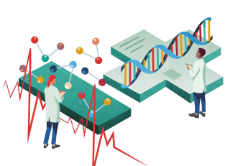

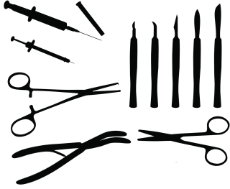







 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026
Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026
Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


