Katrin Staffler (CSU) ist die neue Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung. Im Interview mit ersatzkasse magazin. spricht sie über ihre pflegepolitischen Schwerpunkte in dieser Legislaturperiode und ihre Erwartungen an die Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Pflegereform, die am 7. Juli 2025 ihre Arbeit aufgenommen hat. Vorrangiges Ziel ist, weitere Beitragssatzerhöhungen in der Pflegeversicherung zu verhindern und strukturelle Reformen auf den Weg zu bringen.

Frau Staffler, Sie sind von Haus aus studierte Chemikerin und haben jetzt die Funktion der Pflegebevollmächtigten inne. Was reizt Sie persönlich an dieser neuen Aufgabe?
Katrin Staffler: Ich möchte den Pflegebedürftigen und deren Angehörigen eine Stimme in den Gesetzgebungsverfahren und im politischen Handlungsprozess verleihen und ihre Interessen vertreten. Von der Pflegebevollmächtigten würden einige zunächst erwarten, dass sie aus dem Pflegebereich kommt. Doch den Fokus, den ich für meine Arbeit haben muss – nämlich mich auf diejenigen zu konzentrieren, die pflegebedürftig sind, und auf die Familien, die dahinterstehen – habe ich aus meiner eigenen Mitte heraus. Denn ich bin selbst Angehörige einer pflegebedürftigen Person in meinem engsten Familienkreis und als CSU-Abgeordnete liegen mir soziale Themen per se sehr am Herzen. Mit der großen Pflegereform und der zukunftsfesten Aufstellung der Pflege, über die wir auch in der neuen Bund-Länder- Arbeitsgruppe „Zukunftspakt Pflege“ sprechen, steht da jetzt eine Riesenaufgabe an.
Wie verorten Sie sich und Ihre Rolle im Verhältnis zum Gesundheitsministerium?
Ich sehe mich als Fürsprecherin der pflegebedürftigen Menschen, pflegenden An- und Zugehörigen und auch der Pflegekräfte, die für die Versorgung essenziell sind. Im Ministerium stehen wir in enger Abstimmung zu allen Vorhaben in der Pflege. Die Bundesministerin ist mit einem Schwerpunkt auch auf die Neuausrichtung der Pflege gestartet. Insofern renne ich hier offene Türen ein, wenn ich das Pflegethema immer wieder anspreche und in den Fokus rücke.
Zurzeit wird viel über kurzfristige Maßnahmen zur Stabilisierung der sozialen Pflegeversicherung (SPV) diskutiert. Der Beitragssatz ist von 2,35 Prozent vor zehn Jahren auf aktuell 3,6 Prozent gestiegen, plus Kinderlosenzuschlag von derzeit 0,6 Prozent. Wie lange soll das noch so weitergehen?
Wir haben das Ziel, die Beiträge stabil zu halten. Deshalb müssen wir über die Finanzlage sprechen. Ich unterstütze die Ministerin auch klar in ihrer Haltung, dass die im Haushalt vorgesehenen Darlehen in Höhe von 2 Milliarden Euro – also 0,5 Milliarden Euro für 2025 sowie 1,5 Milliarden Euro für 2026 – nicht ausreichen. Das ist das eine. Das zweite ist aber, dass wir auch die Strukturen verändern müssen, wenn wir das System langfristig tragfähig halten und Beitragssatzerhöhungen verhindern wollen. Sonst haben wir in zwei oder vier oder fünf Jahren wieder die gleichen Probleme.
Darlehen werden also das Problem nicht lösen, sie müssen ja auch zurückgezahlt werden. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken hat sich ja gleich zu Beginn ihrer Amtszeit dafür eingesetzt, dass die SPV eine Erstattung für die coronabedingten Sonderkosten in Höhe von rund 5 Milliarden Euro erhält, aber nicht als Darlehen. Allerdings konnte sie sich hier bislang nicht durchsetzen. Ist dieses Anliegen jetzt aufgeschoben?
Nein, denn die Verhandlungen zum eingebrachten Haushalt haben gerade erst begonnen und wir werden in zahlreichen Gesprächen mit den Kolleginnen und Kollegen intensiv darauf hinwirken, im Haushalt mehr für die Pflegeversicherung zu erreichen.
Sind Sie grundsätzlich der Meinung, dass versicherungsfremde Leistungen dauerhaft refinanziert werden sollten?
Ich bin klar der Meinung, dass die Pflegeversicherung nachhaltig und generationengerecht umgestaltet werden muss, sonst stehen wir in ein paar Jahren wieder am gleichen Punkt wie heute. Und dazu gehört für mich, dass gesamtgesellschaftliche Aufgaben nicht allein die Pflegebedürftigen schultern sollten. Versicherungsfremde Leistungen wie die 5 Milliarden Euro für die Corona-Hilfen müssen der Pflegeversicherung vom Bund erstattet werden. Auch die Rentenversicherungsbeiträge für pflegende Angehörige von jährlich 4 Milliarden Euro und die Ausbildungskosten für Pflegekräfte von etwa 3 Milliarden Euro können nicht allein die Aufgabe der Pflegeversicherung sein.
Somit kommen wir auf die Bund-Länder-AG zur Pflegereform zu sprechen, die am 7. Juli dieses Jahres ihre Arbeit aufgenommen hat, wo es ja auch um strukturelle Reformen gehen soll. Worum ging es in der ersten Sitzung, was soll die AG leisten?
Wir haben uns selbst einen Arbeitsauftrag gegeben, der deutlich detaillierter ist als das, was im Koalitionsvertrag festgelegt ist. In der ersten Runde haben die einzelnen Teilnehmenden ihre Schwerpunkte benannt. Bei den wesentlichen Punkten Versorgung und Finanzierung sind wir uns einig, dass dringender Handlungsbedarf besteht. Bis Ende dieses Jahres sollen die Ergebnisse dann auf dem Tisch liegen. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel.
Nun gehen die gesellschaftlichen Vorstellungen über die Weiterentwicklung der Pflege stark auseinander. Zum Thema Vollversicherung etwa hat Nina Warken ihre Position bereits deutlich gemacht – also, dass die Pflegeversicherung eine Teilkaskoversicherung bleiben wird.
Die Pflegeversicherung war nie als Vollversicherung angelegt, insofern unterstütze ich die Ministerin in ihrer Aussage. Aus meiner Sicht geht es allerdings vielmehr um die Frage, wie wir es schaffen, das System durch mehr Pragmatismus und Vereinfachungen zielgenauer zu machen. Zurzeit bewegen wir uns durch einen regelrechten Leistungsdschungel. Das Ziel muss ein effizienter Mitteleinsatz sein, mit wirkungsorientierter Planung und Steuerung. Zum Beispiel könnten Leistungen gepoolt, also zusammengefasst werden, um sie flexibler einsetzen zu können.
Und wie sieht es beim Thema Leistungskürzungen aus, das auch immer wieder diskutiert wird?
Ich weiß nicht, ob wir wirklich in die Kürzung von Einzelleistungen gehen sollten. Mehr Individualität und Zielgenauigkeit, Leistungen zusammenführen, den Pflegebedürftigen mehr Flexibilität ermöglichen, das ist der richtige Weg.
Im Koalitionsvertrag steht, dass die Bund-Länder- AG die Einführung einer Karenzzeit prüfen soll – also, dass Pflegebedürftige zunächst die Pflege selbst zahlen und die Pflegeversicherung erst nach einer bestimmten Zeit die Leistungen übernimmt. Würde das zu einer Entlastung führen – und welche Konsequenzen hätte das für die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen?
Am Ende des Tages dürften wir keine Denkverbote haben, aber wir müssen dabei die Bedürfnisse der Pflegebedürftigen berücksichtigen, und dass die Pflegeversicherung ohnehin nur Teilkosten absichert. Ich kann mir besser vorstellen, dass wir überlegen, inwieweit im Pflegegrad 1 das Thema Prävention deutlich gestärkt werden kann. Es geht um sinnvolle Angebote, die auf den Erhalt der Fähigkeiten und Selbstständigkeit zielen. Das zögert nicht nur Pflegebedürftigkeit hinaus oder verhindert sie, sondern bedeutet für jede und jeden einzelnen auch mehr Lebensqualität.
Welche Rolle spielt das Thema Eigenvorsorge in der Pflege? Mehr kapitalgedeckte Vorsorge und Eigenverantwortung kann sich nicht jede beziehungsweise jeder leisten.
Wichtig ist, dass man sich frühzeitig über eine eventuelle Pflegebedürftigkeit Gedanken macht und für sich und seine Angehörigen eine Entscheidung trifft, wie man versorgt werden möchte und das ermöglicht. Wenn Pflegebedürftige Wünsche haben, die sehr speziell und auch finanzintensiv sind, braucht es mehr finanzielle Eigenvorsorge. Wenn das familiäre oder soziale System so ausgelegt ist, dass es im Pflegefall einspringen kann – dann muss ich vielleicht eher dahinein investieren.
Seit vielen Jahren gibt es eine intensive Debatte darüber, einen Finanzausgleich zwischen der gesetzlichen und privaten Pflegeversicherung zu schaffen. Wie stehen Sie dazu?
Auch darüber werden wir sicher diskutieren. Aber nochmal: Mehr Geld allein, woher es auch immer kommt, bekämpft nur das Symptom, nicht die zugrunde liegenden strukturellen Probleme. Die müssen wir an erster Stelle angehen.
Kommen wir zu den Eigenanteilen in stationären Pflegeeinrichtungen, die stetig steigen und die Pflegebedürftigen finanziell schwer belasten. Welche Ansätze diskutieren Sie da?
Die Steigerung der Kosten müssen wir intensiv im Blick behalten. Das ist ein großes Thema, weil es Pflegebedürftige und ihre Familien enorm belastet. Tatsache ist, dass Pflege sehr personalintensiv ist und ein Großteil der Kosten durch die Löhne der Beschäftigten entsteht. Da können und wollen wir nicht sparen. Es gibt aber andere Punkte, wie zum Beispiel die Investitionskosten von monatlich 500 Euro, für die eigentlich die Länder zuständig sind. Oder auch die Kosten für medizinische Behandlungspflege, die in stationären Einrichtungen bisher nicht von der Krankenkasse übernommen werden. Genauso wie auch die schon erwähnte Ausbildungsumlage. Aber auch hier gilt es effizienter zu werden, zum Beispiel durch mehr Digitalisierung, eine bessere interprofessionelle Zusammenarbeit, vereinfachte Prüfverfahren und pragmatische sektorenübergreifende Lösungen.
Das Gesetzgebungsverfahren zum Pflegefachassistenzgesetz und Pflegekompetenzgesetz haben Sie jetzt wieder aus der Schublade geholt. Die Ampelregierung hatte ja schon entsprechende Gesetze in der Pipeline. Warum sind Ihnen die Gesetze wichtig?
In der alten Legislaturperiode sind sie leider nicht mehr umgesetzt worden und an einigen Stellen gab es ja auch noch Anpassungsbedarf. Aber jetzt ist ein essenzieller Schritt der Weiterentwicklung an der Stelle möglich. Mit dem Pflegekompetenzgesetz können Pflegefachpersonen endlich das, was sie gelernt haben, auch tatsächlich anwenden. Und mit dem Pflegeassistenzgesetz schaffen wir die Grundlage für die Durchlässigkeit der Ausbildung und auch die Anerkennung in allen Bundesländern. Beide Gesetze tragen zu einem modernen, zeitgemäßen Berufsbild bei und erhöhen die Attraktivität des Berufes. Denn die Bezahlung ist schon lange nicht mehr das Problem. Mittlerweile ist der Pflegeberuf einer der am besten bezahlten Ausbildungsberufe.
Sprechen Sie sich in diesem Kontext auch für eine Akademisierung der Pflege aus?
Natürlich ist es wichtig, Karrieremöglichkeiten auf unterschiedlichen Stufen innerhalb eines Berufsbildes zu haben. Mindestens genauso wichtig ist, dass die Akademisierung sinnvoll für die Versorgung ist.
Auch wenn in der Öffentlichkeit vor allem über die stationäre Pflege geredet wird, verhält es sich doch so, dass vier von fünf Pflegebedürftigen zu Hause gepflegt werden. Welche Angebote braucht es hier, um Pflegebedürftige in ihrem häuslichen Umfeld zu unterstützen?
Ein großes Problem ist, dass unterstützende Angebote, zum Beispiel in den Bereichen Tagespflege, Kurzzeitpflege oder Betreuung, oft gar nicht oder nicht genug vorhanden sind. Wir müssen in vielen Bereichen Angebotsstrukturen schaffen, die die Bedürfnisse der Pflegebedürftigen decken.
Wie können insbesondere auch die pflegenden Angehörigen besser unterstützt werden?
Pflegende Angehörige reiben sich viel zu oft zusätzlich zur eigentlichen Pflege an eigentlich schlichten Organisationsfragen auf. Ein Schwerpunkt meiner Arbeit wird daher sein, die Kommunen besser in den Blick zu nehmen. Wenn es da gelingt, durch eine gute Pflegestrukturplanung die Infrastruktur zu verbessern und zusätzlich noch ein Case Management zu installieren, dann macht das für pflegende Angehörige vieles einfacher. In Bayern beispielsweise werden jetzt flächendeckend Pflegestützpunkte implementiert. Von Berlin aus können wir zwar Rahmenbedingungen schaffen, aber implementiert und umgesetzt werden muss das vor Ort, auch mit ganz niedrigschwelligen Angeboten. Wenn uns das im gemeinsamen Schulterschluss zwischen Bund, Ländern und Kommunen gelingt, gewinnen wir viel. Deshalb ist es gut, dass die kommunalen Spitzenverbände auch in der Arbeitsgruppe mit am Tisch sitzen.
Welche Chancen sehen Sie für Digitalisierung, Robotik & KI in der Pflege?
Digitalisierung ist ein essenziell wichtiges Zukunftsthema in der Pflege. Sie kann unter anderem den Bürokratieabbau in der Pflege beschleunigen und Pflegekräfte entlasten, etwa bei der verpflichtenden Pflegedokumentation. Oder die Patientenkommunikation vereinfachen mit dem Einsatz von KI-Sprachassistenz. Dasselbe gilt für die Häuslichkeit. Viele Menschen könnten mit digitalen oder assistierenden Systemen länger selbstständig zu Hause leben. In der Umsetzung haben wir leider noch nicht die nötige Geschwindigkeit. Hier gibt es noch Luft nach oben.
Und wo sehen Sie denn die Pflege in den nächsten fünf Jahren?
Was mir sehr gefallen hat, ist die große Resonanz in der Breite der Bevölkerung, die der Start der Bund-Länder-AG für die Pflegereform gezeigt hat. Es muss uns gelingen, das Thema Pflege wirklich in die Mitte der Gesellschaft zu bringen und uns als sorgende Gemeinschaft aufzustellen. Dazu gehört es, Sektorengrenzen und Bürokratie abzubauen, weniger Kontrollen, mehr Freiheit auch neue Wege auszuprobieren und die Menschen mehr mitbestimmen zu lassen, wie und wo sie gepflegt werden wollen.
Weitere Artikel aus ersatzkasse magazin. (4. Ausgabe 2025)
-
 Interview mit Katrin Staffler
Interview mit Katrin Staffler„In der Pflegeversicherung brauchen wir stabile Finanzen und strukturelle Reformen“













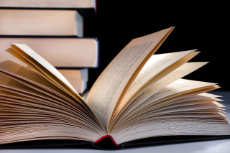
 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026
Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026
Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


