Die Zahl der Pflegebedürftigen hat sich seit 2014 auf mehr als 5,6 Millionen verdoppelt. Damit der Medizinische Dienst einen Beitrag zu einer möglichst bedarfsgerechten Versorgungsplanung für die Versicherten leisten kann, sollte die Pflegebegutachtung modernisiert, weiterentwickelt und flexibilisiert werden.
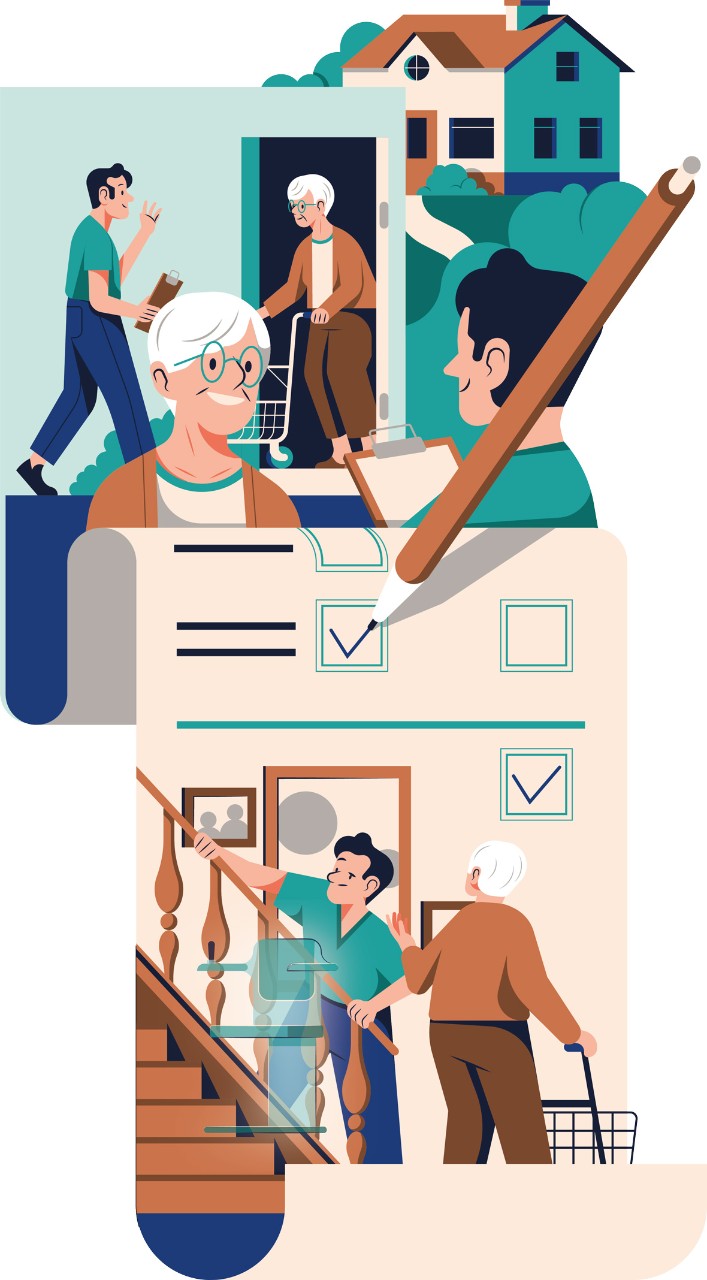
Ursachen für die steigende Zahl der Pflegebedürftigen sind einerseits die demografische Entwicklung und andererseits die Pflegereform 2017: Körperliche, kognitive, psychische und psychiatrische Beeinträchtigungen werden seitdem bei der Feststellung des Pflegegrades umfassend berücksichtigt. Neben der finanziellen Stabilisierung der sozialen Pflegeversicherung (SPV) sind strukturelle Reformen erforderlich. Ein wichtiger Baustein, damit eine möglichst bedarfsgerechte Versorgungsplanung gelingen kann, ist die Pflegebegutachtung. Die Gutachterinnen und Gutachter sind oftmals die ersten professionellen Ansprechpersonen, mit denen die Pflegebedürftigen und ihre An- und Zugehörigen Kontakt haben. Bei der Erstbegutachtung kommt es ganz besonders darauf an, die Weichen so zu stellen, dass sich die Pflegesituation stabilisiert – vor allem dort, wo keine professionelle Unterstützung eingebunden ist.
Für den ersten Report Pflegebedürftigkeit, der kürzlich öffentlich vorgestellt wurde, hat der Medizinische Dienst Bund Daten aus über 3 Millionen Pflegebegutachtungen im Jahr 2024 vertiefend ausgewertet. Sie geben Auskunft darüber, wie die Pflegebedürftigen leben, wie sie ihre Versorgungssituation organisieren und welche Maßnahmen der Medizinische Dienst empfiehlt, um ihre Selbstständigkeit zu stärken.
Knapp 90 Prozent der Pflegebedürftigen leben in eigener Häuslichkeit − mehr als jede und jeder zweite von ihnen organisiert die Versorgung ohne Pflegedienst. Das zeigen die beantragten Leistungen: 57,4 Prozent der Versicherten beantragten Pflegegeld, 11,6 Prozent ambulante Leistungen und 20,4 Prozent eine Kombination aus Pflegegeld und Sachleistungen. Einen Antrag auf vollstationäre Pflege stellten nur 10,2 Prozent. Seit der Pflegereform 2017 erhalten mehr jüngere Menschen (18 bis 59 Jahre) einen Pflegegrad. Dies erklärt sich durch die bessere Berücksichtigung von psychischen, psychiatrischen und kognitiven Beeinträchtigungen beim Pflegegrad.
Die Zahl der Begutachtungen bei Kindern hat sich in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht (von 53.000 Begutachtungen im Jahr 2015 auf 162.000 im Jahr 2024). Dennoch liegt der Anteil der Kinderbegutachtungen insgesamt nur bei rund 3,4 Prozent. Hyperkinetische Störungen wie ADHS und Entwicklungsstörungen sind die häufigsten pflegebegründenden Diagnosen. Auch Kinder und Jugendliche werden meistens zu Hause ohne professionelle Unterstützung versorgt.
Aus unserer Sicht sollte sich die Pflegebegutachtung im Hausbesuch auf die Versicherten fokussieren, die in eigener Häuslichkeit leben. Gerade am Anfang der Pflegebiografie kann mithilfe der hohen pflegefachlichen Kompetenz der Gutachterinnen und Gutachter ein wertvoller Beitrag zur Stabilisierung der Versorgungssituation geleistet werden. Diese stellen nicht nur den Pflegegrad fest, sondern sie sprechen individuelle Empfehlungen aus, um eine Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit zu verhindern: So erhalten zwei von drei Pflegebedürftigen (62,8 Prozent) in der Erstbegutachtung eine Heilmittelempfehlung wie Physiotherapie oder Ergotherapie. Knapp jede und jeder Zweite (43 Prozent) bekommt in der Erstbegutachtung eine Hilfsmittelempfehlung für eine Gehhilfe, eine Dusch- oder Badehilfe oder für ein Behindertenfahrzeug.
In Fallkonstellationen, in denen die professionelle Pflege – sei es durch einen ambulanten Pflegedienst oder eine stationäre Einrichtung – eingebunden ist, sollten Synergien durch bereits vorliegende Informationen viel mehr genutzt werden als bisher. Klar ist aber auch: Die Begutachtung hat weiterhin interessensneutral und unabhängig zu erfolgen. Darüber hinaus sollte der Medizinische Dienst auf Grundlage der Begutachtungs- Richtlinien flexibel entscheiden können, welches Begutachtungsformat im Einzelfall geeignet ist: ob vorliegende Informationen ausreichen, ob ein Interview per Telefon oder Video sinnvoll ist. Hierzu bedarf es der Anpassung gesetzlicher Regelungen.
Die Pflegebegutachtung muss moderner werden und sich an der jeweiligen Versorgungssituation ausrichten. Vor allem Pflegebedürftige und ihre Angehörigen, die am Anfang ihrer Pflegebiografie stehen, gilt es intensiver zu unterstützen. Dies könnte durch das Anstoßen eines initialen Fallmanagements des Medizinischen Dienstes bei der Pflegebegutachtung geleistet werden. Ziel dabei ist, die Pflegesituation unmittelbar zu verbessern und für die Versicherten die Brücke zwischen allen beteiligten Akteurinnen und Akteuren zu schlagen und die Vernetzung zu fördern: zwischen Pflegekassen, Kommunen, Pflegeberatungen und Leistungserbringenden. Die pflegefachliche Kompetenz der Gutachterinnen und Gutachter kann hier einen wertvollen Beitrag für die Einleitung eines individuellen Fallmanagements leisten.
Weitere Artikel aus ersatzkasse magazin. (4. Ausgabe 2025)
-
 Interview mit Katrin Staffler
Interview mit Katrin Staffler„In der Pflegeversicherung brauchen wir stabile Finanzen und strukturelle Reformen“













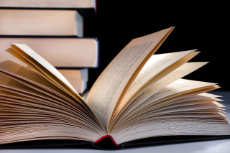
 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026
Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026
Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


