Die Arztpraxis hat Zukunft – aber nicht in ihrer herkömmlichen Form: Beim vdek-Zukunftsforum „Arztpraxis 2.0“ in Berlin wurde darüber diskutiert, wie neue Berufsbilder, Digitalisierung und eine effiziente Arbeitsteilung die ambulante Versorgung verbessern können. Damit das gelingt, müssten Gesetzgeber und Selbstverwaltung für die passenden Rahmenbedingungen sorgen.

Die Suche nach der „Arztpraxis 2.0“ begann auf dem vdek-Zukunftsforum am 17. Juni 2025 mit einem Blick auf den ländlichen Raum: Hier verdichte sich, so vdek-Vorstandsvorsitzende Ulrike Elsner, die doppelte demografische Herausforderung „einer älter werdenden Gesellschaft bei gleichzeitigem Personalmangel“. Um trotzdem eine flächendeckende und niedrigschwellige Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten, seien neue Wege gefragt, denn: „Unabhängig von Wohnort, Alter oder Lebenssituation gut versorgt zu werden, ist eine Erwartung, die die Menschen zu Recht haben.“
Spürbare Entlastung durch neue Gesundheitsberufe
Das Modell „Regionale Gesundheitspartner der Ersatzkassen“, das aktuell in drei Regionen getestet wird, diente bei der Veranstaltung als Praxisbeispiel dafür, wie die Arztpraxis der Zukunft aussehen kann. Konkret soll sich zeigen, wie Delegation und der Einsatz digitaler Hilfsmittel die ambulante Versorgung verbessern und zukunftssicher aufstellen können: Die Partner setzen verstärkt auf neue Gesundheitsberufe wie Physician Assistants (PAs) oder Nichtärztliche Praxisassistent:innen (NäPA), welche – ausgestattet etwa mit einem Telemedizin-Rucksack für den Hausbesuch – die behandelnden Ärztinnen und Ärzte im Praxisalltag entlasten. Die Praxisberichte auf dem vdek-Zukunftsforum waren durchweg positiv: Die anwesenden Partner sprachen nicht nur von einer spürbaren Entlastung im Arbeitsalltag, sondern auch von einer hohen Akzeptanz bei Patientinnen und Patienten. Für Elsner ist das Ziel klar: Es darf nicht bei Modellversuchen bleiben, stattdessen muss die Delegation von ärztlichen Leistungen Teil der Regelversorgung werden.
Dass auf dem Weg dorthin auch Überzeugungsarbeit nötig ist, betonte Dominik Graf von Stillfried, Vorstandsvorsitzender des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi): Es gelte, das Mantra der „höchstpersönlichen Leistungserbringung“ durch Arzt oder Ärztin zu lockern. Dem pflichtete Prof. Dr. Ferdinand M. Gerlach, Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin der Universität Frankfurt am Main, bei, zumal dieses Verständnis hierzulande auch das „Dogma der Honorierung“ sei. Aus Sicht Gerlachs ist die in Deutschland geführte Diskussion überhöht: Es sei zu bezweifeln, dass in Ländern, wo Versorgung im Team bereits gelebter Alltag sei, groß über „Delegation“ gesprochen werde. Ohnehin zeichne sich ab, dass ärztliche Tätigkeiten in Zukunft nicht nur auf Menschen übertragen werden: „KI-Agenten werden Teil der Teams sein.“ Diese Entwicklung müsse schon jetzt mitgedacht werden.
Standards in der Ausbildung, Flexibilität in der Praxis
Am Beispiel des noch jungen Berufsbildes Physician Assistant brachten Prof. Dr. Katharina Larisch, Professorin für Physician Assistance an der CBS University of Applied Sciences, sowie Daria Hunfeld, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Physician Assistants (DGPA), praktische Hürden zur Sprache. Diese beträfen zum einen die Ausbildung: Larisch forderte eine Standardisierung des PA-Studiums. Eine vergleichende Untersuchung des praktischen Anteils der PA-Ausbildung an Hochschulen habe teils erhebliche Unterschiede offengelegt, wie Larisch am Beispiel der körperlichen Untersuchung aufzeigte: „In 40 Stunden kann man wirklich etwas lernen, in fünf Stunden nicht.“ Hunfeld ergänzte: „PA-Fernstudiengänge ohne Praxisanteile lehnen wir als DGPA ab.“
Im Praxisalltag fehle teilweise auch rechtliche Klarheit. Larisch berichtete von einer Unsicherheit bei Ärztinnen und Ärzten, welche Leistungen überhaupt delegiert werden dürfen. Hunfeld forderte in diesem Kontext ein entsprechendes Berufsgesetz. Auch von Stillfried sprach sich für eine Kodifizierung von Kompetenzen aus, warnte aber vor einem zu starren Katalog delegierbarer Leistungen: „Wir brauchen Flexibilität, die Möglichkeit zur Anpassung an den individuellen Bedarf.“ Die Delegationsentscheidung sei auf Ebene der Praxiseinheit zu treffen.
Keine Leistung zweiter Klasse
Zur Sprache kam auch das Thema Vergütung. Für Physician Assistants gibt es in Deutschland aktuell keine eigene Abrechnungsziffer, die Abrechnung erfolgt über den delegierenden Arzt oder die delegierende Ärztin. Hunfeld appellierte an die gemeinsame Selbstverwaltung, dass dies so bleiben müsse, denn die Behandlung durch PAs sei „keine Leistung zweiter Klasse“, die Letztverantwortung bleibe immer beim Arzt oder der Ärztin. „PAs einzustellen, muss für Hausarztpraxen attraktiv sein“, betonte Boris von Maydell, Leiter der Abteilung Ambulante Versorgung beim vdek.
Für von Maydell sind eine standardisierte Ausbildung von PAs sowie eine „gewisse Definition delegierbarer Leistungen“ zwar richtig, zu komplizierte Regelungen verschöben den nötigen Systemwandel jedoch zu weit in die Zukunft. Die drei „Regionalen Gesundheitspartner“ zeigten, was bereits unter den aktuellen Rahmenbedingungen möglich sei. Die Zukunft ist nah: Dieser Eindruck entstand auch am Ende, als die Podiumsteilnehmenden befragt wurden, in wie vielen Jahren sie sich über die heutige Diskussion wundern und also Delegation, Digitalisierung und effiziente Arbeitsteilung ganz natürliche Teile des ambulanten Alltags geworden sein dürften. Die höchste Zahl lautete zehn, die niedrigste drei Jahre.
Weitere Artikel aus ersatzkasse magazin. (4. Ausgabe 2025)
-
 Interview mit Katrin Staffler
Interview mit Katrin Staffler„In der Pflegeversicherung brauchen wir stabile Finanzen und strukturelle Reformen“













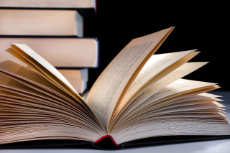
 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026
Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026
Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


