Vor gut zwei Jahren ist das Projekt Universitäres Telemedizin Netzwerk (UTN) im Netzwerk Universitätsmedizin (NUM) gestartet, im Sommer dieses Jahres fand es seinen Abschluss. Projektleiter Prof. Dr. Gernot Marx von der Uniklinik RWTH Aachen erläutert, worum es bei dem Projekt ging und wie es zu einer besseren telemedizinischen Versorgung beiträgt.

Welche Ziele hat das UTN-Projekt verfolgt und inwiefern auch erreicht?
Das Universitäre Telemedizin Netzwerk (UTN) ist ein Forschungsprojekt in der Förderperiode 2.0 des Netzwerks Universitätsmedizin (NUM). Ziel war es, nationale Standards für die telemedizinische Datenerfassung und -integration zu entwickeln und damit eine belastbare Grundlage für telemedizinisch gestützte klinische Forschung zu schaffen. Bis Juni 2025 wurden ein konsolidiertes Infrastrukturkonzept, technische Standards sowie Datenschutz- und Ethikbausteine erarbeitet. Zudem liegt eine konsentierte AWMF S3-Leitlinie „Telemedizin in der Intensivmedizin“ vor, deren Veröffentlichung für Oktober 2025 geplant ist. Damit steht ein nachhaltiges Universitäres Telemedizin Netzwerk bereit, das zukünftig in die Infrastruktur des NUM eingebettet sein wird und durch exzellente klinische Forschung die Versorgung langfristig verbessert.
Welche Chancen bietet Telemedizin für Forschung und Versorgung?
Telemedizin eröffnet neue Möglichkeiten, klinische Forschung und Patientenversorgung enger miteinander zu verzahnen. Für die Forschung bedeutet sie den Zugang zu standardisierten, hochskalierten und insbesondere longitudinal erhobenen Daten, die standortübergreifend vergleichbar sind und ein umfassenderes Bild von Krankheitsverläufen und Behandlungsergebnissen ermöglichen. Für die Versorgung schafft Telemedizin die Grundlage für evidenzbasierte, ortsunabhängige Betreuung und verbessert damit Patientensicherheit und Versorgungsqualität. Durch diese enge Verbindung von Forschung und klinischer Praxis kann Wissen schneller in die Versorgung übertragen werden – und zugleich fließen Versorgungserfahrungen unmittelbar in die Forschung zurück.
Wie haben sich Notwendigkeit und Akzeptanz von Telemedizin in den Jahren verändert?
Wir wissen heute, dass wir durch Telemedizin in der Lage sind, Kolleginnen und Kollegen unterschiedlicher Kompetenz zu vernetzen, wir können Therapien optimieren und auch dafür sorgen zu entscheiden, welche Patienten verlegt werden sollten und welche nicht; und dies unabhängig von Ort und Verfügbarkeit. Das ist keine technische Spielerei, sondern es ist das Rückgrat moderner Medizin. Schon in der Pandemie konnte zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen und auch in Berlin gezeigt werden, dass durch intensivmedizinische digital-gestützte Telemedizinnetzwerke Spitzenintensivmedizin mit höchster Kompetenz flächendeckend telemedizinisch angeboten werden konnte. Zusätzlich konnte deutlich belegt werden, dass es einen relevanten und nachweisbaren patienten- und versorgungsstrukturellen Nutzen einer vernetzten Zusammenarbeit von Intensivmedizinern in der Fläche und der zusätzlichen telemedizinischen Unterstützung aus ausgewiesenen intensivmedizinischen Expertenzentren gibt. Durch vernetzte intensivmedizinische Zentren wird eine langfristige Perspektive für die Sicherstellung einer hochqualitativen und flächendeckenden intensivmedizinischen Versorgung auch in Bedrohungslagen in Deutschland sichergestellt werden. Die Akzeptanz der Telemedizin wird immer besser und hat ohne Zweifel durch die Pandemie einen wichtigen positiven Impuls erhalten
Weitere Artikel aus ersatzkasse magazin. (5. Ausgabe 2025)
-
 BEEP und Pflegefachassistenzausbildung
BEEP und PflegefachassistenzausbildungAktuelle Gesetzgebung: Pflege stärken, Bürokratie bremsen?















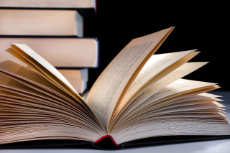
 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026
Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026
Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


