Mit dem Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege (BEEP) und der Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefachassistenzausbildung will das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) den Pflegeberuf attraktiver machen, dem Fachkräftemangel begegnen und die Pflege entbürokratisieren. Ziel ist eine zügige Stabilisierung der Pflege in Deutschland. Doch zwischen berechtigtem Fortschritt und bloßer Symbolik liegen Fallstricke.

Das Herzstück des BEEP ist die Ausweitung der Kompetenzen und Handlungsspielräume von Pflegefachpersonen. Künftig übernehmen diese eigenverantwortlich heilkundliche Aufgaben wie das Wundmanagement, die Begleitung von Menschen mit Demenz oder die Diabetesversorgung, abgestuft nach der pflegefachlichen Qualifikation. Damit soll die Versorgung effizienter gestaltet werden und die Pflege mehr Eigenständigkeit erhalten. Künftig soll die Zusammenarbeit mit Ärzt:innen auf Augenhöhe erfolgen – bei gleichbleibender Patientensicherheit und verbesserter Versorgung. Die Bundesregierung verspricht sich davon eine Stärkung des Pflegeberufs. Gerade vor dem Hintergrund des gravierenden Fachkräftemangels und der hohen Versorgungslast ist diese Weiterentwicklung der pflegerischen Rolle ein klarer Fortschritt. Die Ersatzkassen begrüßen diese Entwicklung ausdrücklich. Dennoch braucht es eindeutige Regelungen zur Zusammenarbeit zwischen Pflegekräften und Ärzt:innen, um die Heilkundeübertragung erfolgreich und rechtssicher zu gestalten, insbesondere hinsichtlich Haftungsfragen.
Mit der Einführung der Pflegefachassistenzausbildung werden zudem die bisher 27 verschiedenen Ausbildungen in der Pflegehilfe und Pflegeassistenz bundesweit vereinheitlicht. Damit legt der Gesetzgeber die Basis für ein bundesweit einheitliches hohes Qualifikationsniveau für Pflegefachassistenzkräfte und setzt ein zentrales Anliegen der Ersatzkassen um. Bedauerlicherweise droht dabei jedoch eine Schieflage bei der Finanzierung: Im Gegensatz zu kaufmännischen und handwerklichen Ausbildungen beteiligen sich die Länder nicht an der Finanzierung. Stattdessen sollen die Kranken- und Pflegekassen und letztlich die Pflegebedürftigen die finanzielle Last tragen.
Bürokratieabbau – gutes Etikett, wenig Inhalt
So sinnvoll die dargestellte Kompetenzoffensive für die Pflege auch ist, das mit dem BEEP verbundene Versprechen des Bürokratieabbaus entpuppt sich beim Blick in den Kabinettsentwurf teils als zahnloser Tiger.
Ernüchternd ist die geplante Arbeitsgruppe, die über vier Jahre die Formulare und Antragsprozesse in der Pflege vereinfachen soll. Deutlich mehr Tempo wäre geboten, um Pflegebedürftigen rasch den Zugang zu notwendigen Leistungen zu erleichtern. Der Entwurf sollte hier nachgebessert werden, um jahrelange Gremienarbeit ohne einen klaren Nutzen für die Pflegebedürftigen abzuwenden. Eine tatsächliche Entbürokratisierung soll bei den Qualitätsprüfungen für Pflegedienste stattfinden: Analog zu stationären Pflegeeinrichtungen soll, bei guter Qualität, das Prüfintervall auf zwei Jahre ausgedehnt werden. Häusliche Beratungsbesuche bei den Pflegegraden 4 und 5 sollen zukünftig halbjährlich erfolgen. Ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Entbürokratisierung ist zudem die Begrenzung der Pflegedokumentation auf das Notwendigste. So werden Pflegekräfte in der Praxis entlastet. Mit der geplanten Einführung der gemeinschaftlichen Wohnformen (GeWo) droht hingegen neue Bürokratie. Diese verfolgen das Ziel, die pflegerische Versorgung weiter an die individuelle Pflegesituation von Pflegebedürftigen anzupassen – ob dies mit der geplanten, äußerst komplizierten Regelung und einer damit verbundenen neuen Anbieter- und Vertragsstruktur gelingen wird, ist fraglich. Vor dem Hintergrund, dass derzeit im „Zukunftspakt Pflege“, also der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Erarbeitung einer Pflegereform, die Aufhebung von Sektorengrenzen und eine echte Überwindung des Nebeneinanders diskutiert wird, ist die Neuerung zu hinterfragen. Denn statt Verschlankung wird hier weiter ausdifferenziert und ein neuer Sektor aufgebaut.
Mutiges Signal, aber viele offene Baustellen
Insgesamt markieren die Pflegegesetze einen klaren Fortschritt für die praktische Versorgung. Sie erweitern die Handlungsspielräume von Pflegekräften und schaffen neue Perspektiven. Der versprochene Abbau von Bürokratie bleibt in der Praxis weitgehend wirkungslos.
Die Pflegegesetze weisen zudem eine klare Schwachstelle auf: Für die drängenden Fragen einer zukunftsfähigen Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung liefert das BEEP keine Lösungen. Die lauten Forderungen sowohl nach der notwendigen Dynamisierung der Leistungsbeträge als auch zur Finanzierung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben durch die Länder und den Bund verhallen bisher ungehört. Statt seine Schulden zu begleichen, bietet der Gesetzgeber Darlehen an.
Solange die eklatanten Finanzierungslücken in der sozialen Pflegeversicherung nicht geschlossen, Pflegende in ihrem Alltag nicht wirklich entlastet und weiter bürokratische Parallelwelten geschaffen werden, besteht die Gefahr, dass aus gut gemeinter Entlastung ein Placebo wird. Für die Zukunft der Pflege wird entscheidend sein, ob der Gesetzgeber schnell wirkungsvolle Konzepte für eine nachhaltige und generationengerechte Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung findet, die Digitalisierung angeht und konsequent Bürokratie abbaut. Nur so wird die nächste Pflegereform nicht nur gut klingen, sondern auch im Alltag spürbar werden.
Weitere Artikel aus ersatzkasse magazin. (5. Ausgabe 2025)
-
 BEEP und Pflegefachassistenzausbildung
BEEP und PflegefachassistenzausbildungAktuelle Gesetzgebung: Pflege stärken, Bürokratie bremsen?















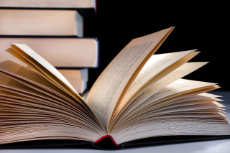
 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026
Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026
Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


