Die Notfallversorgung in Deutschland leidet unter Überlastung und Fehlsteuerung. Notaufnahmen und Rettungsdienste werden oft für Bagatellfälle genutzt, während echte Notfälle zu lange warten. Die Reform muss klare Zugangswege schaffen: Integrierte Notfallzentren mit „Gemeinsamem Tresen“, Gesundheitsleitstellen als zentrale Steuerungseinheiten und ein im SGB V verankerter Rettungsdienst sind die entscheidenden Bausteine.
Nachdem im Oktober 2024 das Notfallgesetz im ersten Durchgang den Bundestag passiert hat, schien der gordische Knoten durchschlagen. Die Diskussionen darüber, wie man die Notfallstrukturen besser nutzt und gleichzeitig die Versicherten mit dringendem Behandlungsbedarf adäquat versorgt, dauerte schon viele Jahre. Die Ersatzkassen hatten bereits 2016 dazu Vorschläge gemacht – und viele der Vorschläge fanden sich dann auch im Gesetzesentwurf wieder. Dann kam der Bruch der Ampelkoalition. Nun steht die Reform der Notfallversorgung auf der Aufgabenliste einer weiteren Bundesregierung. Und die Probleme werden immer drängender.
Die Notfallversorgung in Deutschland steht seit Jahren unter Druck. Rettungsdienste, Notaufnahmen und der ärztliche Bereitschaftsdienst werden regelmäßig für Fälle in Anspruch genommen, die medizinisch betrachtet keine Notfälle sind. Bagatellerkrankungen, die eigeninitiativ in Notaufnahmen vorgestellt werden, blockieren Kapazitäten und verlängern Wartezeiten für echte Notfälle. Auch der Rettungsdienst wird häufig ohne akute medizinische Notwendigkeit alarmiert: Hochqualifizierte Ressourcen werden so ineffizient eingesetzt.
Die Folgen sind Über- und Fehlversorgung in allen drei Säulen der Notfallversorgung. Hinzu kommt eine unübersichtliche Struktur: So betreibt etwa Nordrhein-Westfalen bei 17 Millionen Einwohner:innen 53 Leitstellen. Im Vergleich betreibt Sachsen dagegen 5 Leitstellen bei 4 Millionen Einwohner:innen. Parallel ziehen sich die Länder seit Jahren aus ihrer finanziellen Verantwortung für den Rettungsdienst zurück und verlagern Kosten auf die Krankenkassen – obwohl diese gesetzlich nur zur Übernahme der Fahrtkosten verpflichtet sind. Das Ergebnis: eine Kostenexplosion von 3,4 Milliarden Euro (2014) auf 7,5 Milliarden Euro (2024).
Integrierte Notfallzentren mit „Gemeinsamem Tresen“
Ein zentraler Baustein einer Reform müssen aus Sicht der Ersatzkassen Integrierte Notfallzentren (INZ) sein, die Notaufnahmen und KV-Bereitschaftsdienstpraxen bündeln. Herzstück ist der „Gemeinsame Tresen“, an dem Versicherte nach einer Ersteinschätzung der passenden Versorgungsebene zugeführt werden – stationär, ambulant oder in die vertragsärztliche Regelversorgung. Ziel ist es, die Versorgungsstrukturen konsequent an der Dringlichkeit auszurichten. Für den Aufbau der INZ müssen bundesweite Kriterien gelten, die sowohl Bedarfszahlen als auch regionale Besonderheiten berücksichtigen. Flächendeckende Erreichbarkeit – gerade in ländlichen Räumen – ist dabei zwingend.
Generelle Ersteinschätzung
Ein weiteres Kernstück einer Notfallreform sollte aus Sicht der Ersatzkassen die Einführung einer Ersteinschätzung sein, die an allen Kontaktpunkten nach denselben Standards durchgeführt wird. Unabhängig davon, ob Hilfesuchende per Telefon, Video-App oder durch persönliche Vorstellung Kontakt aufnehmen, erfolgt zunächst eine standardisierte Einschätzung und Zuordnung in die richtige Versorgungsebene, gegebenenfalls mit Vermittlung eines passenden Arzttermins in der ambulanten Versorgung. Um die Wartezeiten zu verkürzen und den Notaufnahmen mehr Planungsmöglichkeiten zu geben, sollten Patient:innen, die vorab digital oder telefonisch Kontakt aufnehmen, eine „Fast Lane“ erhalten und somit schneller versorgt werden können. Notaufnahmen hätten dann schon vor Erscheinen der Patienten:innen die Möglichkeit, Behandlungskapazitäten zu reservieren und effizienter zu disponieren. Mit einer verbesserten Terminvermittlungsplattform, die ebenfalls durch die gemeinsame Selbstverwaltung vorangetrieben wird, können Patient:innen, die nach der Ersteinschätzung in der vertragsärztlichen Versorgung behandelt werden können, direkt von der Terminservicestelle einen Termin vermittelt bekommen.
Gesundheitsleitstellen als Steuerzentrale
Ein weiterer Schlüssel ist die organisatorische Zusammenführung der Rufnummern 112 und 116 117. Künftig sollen Gesundheitsleitstellen entstehen, die nicht nur Rettungsdiensteinsätze disponieren, sondern auch Hilfesuchende in die ambulante Versorgung, Pflegeangebote oder psychosoziale Dienste steuern können. Damit dies gelingt, müssen bundeseinheitliche Standards vorgegeben werden – sowohl für die Ersteinschätzung als auch für die technische Interoperabilität der Systeme. Vorbilder gibt es in Dänemark, den Niederlanden und Österreich.
Solche Leitstellen dürfen nicht allein im Ermessen der Länder oder Kommunen stehen, sondern müssen per Bundesgesetz verpflichtend eingeführt werden. Sie können im Idealfall viele Anliegen schon telefonisch klären, unterstützt durch Ärzt:innen, die über telemedizinische Angebote rund um die Uhr erreichbar sind.
Rettungsdienst ins SGB V überführen
Heute wird der Rettungsdienst noch überwiegend als „Transportleistung“ verstanden. Angesichts der Versorgungsrealität muss er aber als integraler Bestandteil der Notfallversorgung im SGB V verankert werden. Das bedeutet: Vergütung nicht nur für Fahrten, sondern auch für die medizinische Versorgung vor Ort. Dafür braucht es verbindliche Qualitätsstandards, einheitliche Versorgungspfade und Kostentransparenz. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) sollte beauftragt werden, eine Richtlinie zur Qualitätssicherung in der Notfallrettung zu entwickeln – inklusive Notfallmanagement, Behandlung und Transport.
Bund und Länder müssen hier gemeinsam Verantwortung tragen. Während der Bund die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen schafft, dürfen sich die Länder ihrer Pflicht zur Finanzierung von Vorhaltekosten und Investitionen nicht länger entziehen.
Fazit
Eine zukunftsfeste Notfallversorgung braucht klar strukturierte Zugangswege, einheitliche Ersteinschätzungen und eine enge Verzahnung aller Beteiligten. INZ mit „Gemeinsamem Tresen“, leistungsfähige Gesundheitsleitstellen und ein im SGB V verankerter Rettungsdienst sind zentrale Bausteine. Entscheidend ist, dass die Reform nicht an föderalen Zuständigkeiten scheitert, sondern verbindlich umgesetzt wird. Nur so können echte Notfälle künftig schneller und besser versorgt werden – bei gleichzeitig effizienterem Einsatz von Ressourcen und Beitragsgeldern.
Weitere Artikel aus ersatzkasse magazin. (5. Ausgabe 2025)
-
 BEEP und Pflegefachassistenzausbildung
BEEP und PflegefachassistenzausbildungAktuelle Gesetzgebung: Pflege stärken, Bürokratie bremsen?
















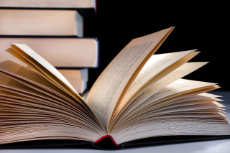
 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026
Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026
Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


