Die Aufgaben und Baustellen in der Gesundheitspolitik sind vielfältig, zugleich drängt die Zeit. Im Interview mit ersatzkasse magazin. sprechen Simone Borchardt, gesundheitspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, und Dr. Christos Pantazis, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, über anstehende Reformen im Gesundheitswesen, über die finanzielle Lage in der gesetzlichen Krankenversicherung (GVK) und sozialen Pflegeversicherung (SPV) sowie über die Notwendigkeit von Zusammenhalt und Kompromissen.

Seit Anfang Mai 2025 ist die neue schwarz-rote Bundesregierung im Amt. Wie lautet Ihre Bilanz der ersten fünf Monate?
Simone Borchardt: Die ersten Monate der neuen schwarz-roten Bundesregierung waren von politischer Bestandsaufnahme geprägt. Die Ampel hat viele Baustellen hinterlassen, die wir jetzt als Arbeitskoalition systematisch angehen. Besonders im Gesundheitswesen geht es darum, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen und zentrale Reformen wieder auf Kurs zu bringen. Ich sehe aktuell den gemeinsamen Willen anzupacken, auch wenn uns da sicherlich die Sommerpause in die Quere gekommen ist. Selbstverständlich bleiben große Herausforderungen, doch die Richtung stimmt.
Dr. Christos Pantazis: Es hat sich gezeigt, dass wir keine Zeit zu verlieren haben. Angesichts historisch hoher Beitragssätze und wachsender Sorgen um die Stabilität unseres Gesundheitswesens ist klar, dass Gesundheitspolitik eine der zentralen Aufgaben dieser Legislaturperiode ist. Im Gesundheitsbereich arbeiten wir deshalb eng, konstruktiv und respektvoll zusammen. Mir ist besonders wichtig, dass wir dabei gemeinsame Kompromisse finden, nur so können wir zügig Ergebnisse für die Menschen erreichen. Erste wichtige Weichen sind gestellt, jetzt kommt es darauf an, Reformen konsequent umzusetzen.
Die Finanzlage in der GKV und SPV sieht nicht gut aus. Die Zusatzbeitragssätze sind Anfang des Jahres massiv gestiegen, 2026 droht eine neue Welle. CDU/CSU und SPD haben im Koalitionsvertrag vereinbart, die Finanzen und Beitragssätze der GKV und SPV zu stabilisieren. Dabei steht die Refinanzierung von versicherungsfremden Leistungen schon länger im Raum, ebenso die Erstattung der Corona-Mehrkosten in der SPV. Dadurch könnten die GKV und SPV viele Milliarden Euro einsparen. Was ist hier noch zu erwarten?
Dr. Christos Pantazis: Die Stabilisierung der Finanzen in der GKV und SPV ist eine der zentralen Aufgaben dieser Koalition. Unser Ziel ist es, das Kostenwachstum zu bremsen und weitere Belastungen für die Beitragszahlerinnen und -zahler zu verhindern – und zwar ohne Leistungskürzungen. Schließlich sind diese bereits in Vorleistung gegangen und zahlen seit Anfang 2025 höhere Zusatzbeiträge. Aus diesem Grund ist es nur richtig, dass das Bundeskabinett beschlossen hat, keine weiteren Beitragssteigerungen umzusetzen. Nun müssen andere Akteurinnen und Akteure ihren Beitrag leisten, die Kosten zu dämpfen. Dafür setzen wir auf einen Mix aus kurzfristigen Maßnahmen und nachhaltigen Strukturreformen. Ein entscheidender Schritt ist die genannte vollständige Refinanzierung versicherungsfremder Leistungen durch den Staat. Dazu gehören insbesondere die kostendeckende Übernahme der Beiträge für Bürgergeldempfangende in der GKV sowie die Erstattung der Corona-Mehrkosten in der SPV. Es sind staatliche Aufgaben und sollten daher auch aus Steuermitteln finanziert werden. Da die haushaltspolitischen Spielräume in den kommenden Jahren eng bleiben, ist es umso wichtiger, dass wir parallel an einer langfristig tragfähigen Finanzierung arbeiten.
Simone Borchardt: Die Finanzlage von GKV und SPV ist angespannt. Wir haben im Koalitionsvertrag klar vereinbart, die beitragsfinanzierte Solidargemeinschaft zu entlasten. Die Verhandlungen dazu laufen, es ist aber kein Selbstläufer, auch wenn es aus ordnungspolitischer Sicht in jedem Falle geboten ist. Grundsätzlich warne ich allerdings davor, dass nun Stimmen laut werden, die Schnellschüsse fordern. Aus meiner Sicht darf der aktuellen „FinanzKommission Gesundheit“ nicht vorweggegriffen werden, wenn man das Ganze systematisch angehen möchte. Diese Kommission soll Maßnahmen für eine dauerhafte Stabilisierung der Beitragssätze in der GKV erarbeiten. Mitte September hat Bundesgesundheitsministerin Nina Warken die zehn Mitglieder berufen, ein erster Bericht wird Ende März 2026 erwartet, ein zweiter im Dezember 2026.
Auch auf der Ausgabenseite sieht es gar nicht gut aus. Die Ausgaben steigen und steigen und liegen deutlich über den Einnahmen, das hat jetzt selbst der Bundesrechnungshof angemahnt und Sparmaßnahmen gefordert, um weitere Beitragsanstiege zu verhindern. Braucht es nicht jetzt einen strikten Sparkurs?
Simone Borchardt: Richtig ist: Wir brauchen Ausgabendisziplin. Aber ein pauschaler Sparkurs wäre gefährlich, weil er an die Substanz ginge. Entscheidend ist, Strukturen effizienter zu machen. Das Prinzip „Digital vor ambulant vor stationär“ muss Leitlinie werden. Jeder Euro, der durch bessere Steuerung und Bürokratieabbau frei wird, ist nachhaltiger als reine Kürzungen.
Dr. Christos Pantazis: Die Einnahmenentwicklung bleibt deutlich hinter der Entwicklung der Ausgaben zurück. Die Beitragssätze steigen. Unser Ziel und zugleich die Herausforderung, Kostenwachstum zu bremsen und weitere Belastungen für die Beitragszahlerinnen und -zahler zu vermeiden, ohne Leistungen zu kürzen, können wir nur gemeinsam mit unseren Partnern im Gesundheitswesen angehen.
Um Beitragssatzerhöhungen zu verhindern, hat die Bundesregierung Darlehen für die GKV und SPV ins Spiel gebracht. Verschiebt man die Probleme nicht dadurch, anstatt sie zu lösen? Die Darlehen müssen ja auch zurückgezahlt werden.
Dr. Christos Pantazis: Darlehen können kurzfristig helfen, akute Finanzierungslücken in der GKV und SPV zu überbrücken. Sie ersetzen aber keine nachhaltige Lösung. Entscheidend bleibt, dass wir die Systeme strukturell stabilisieren. Nur so gelingt es uns, Beitragssätze langfristig stabil zu halten und die hohe Qualität der Versorgung zu sichern.
Simone Borchardt: Darlehen für GKV und SPV sind kein Königsweg. Sie schaffen kurzfristig Luft, lösen aber die Ursachen nicht. Wer sich nur verschuldet, verschiebt die Lasten auf Beitragszahler von morgen. Deshalb gilt: Kredite dürfen nur eine Brücke sein, während wir strukturelle Reformen erarbeiten.
Was versprechen Sie sich von der bereits erwähnten Kommission für die GKV (Ergebnisse bis Ende 2026) sowie der im Juli dieses Jahres gestarteten Bund- Länder-AG zur Pflegereform (Ergebnisse bis Ende 2025)? Was ist Ihnen dabei besonders wichtig?
Simone Borchardt: Die eingesetzten Expertengruppen sind zentrale Bausteine. Sie geben den Raum für belastbare Vorschläge, die nicht nur politische Willensbekundungen sind. Für uns ist wichtig, dass die Kommissionen nicht im Klein-Klein stecken bleiben, sondern systemisch denken: Finanzierung, Versorgungsstrukturen, Digitalisierung. Und sie müssen konkrete Gesetzgebungsvorschläge liefern.
Dr. Christos Pantazis: Ich erwarte vor allem fundierte und evidenzbasierte Lösungsvorschläge. Denn nur auf dieser Grundlage können wir als Politik tragfähige Entscheidungen treffen und nachhaltige Reformen in der GKV und SPV auf den Weg bringen. Dabei geht es mir insbesondere darum, langfristige Stabilität zu sichern, die Qualität der Versorgung zu erhalten und zugleich die Beitragszahlerinnen und -zahler nicht weiter zu belasten.
Die Ampelregierung hat die Krankenhausreform noch auf den Weg gebracht, nun legte das Bundesgesundheitsministerium einen Entwurf zum Krankenhausreformanpassungsgesetz vor. Die Krankenkassen befürchten, dass die Ausnahmeregelungen, die die Bundesländer vorbringen, zulasten der Qualität gehen, die Reform teurer wird und der dringend notwendige Strukturwandel unterbleibt. Was meinen Sie?
Dr. Christos Pantazis: Die Krankenhausreform ist eine der zentralen gesundheitspolitischen Aufgaben dieser Legislatur und darf nicht verwässert werden. Angesichts der angespannten Finanzlage der GKV müssen wir das sehr genau im Blick behalten. Unser Ziel bleibt unverändert: Qualität und Effizienz in der Versorgung spürbar zu steigern und, gerade in ländlichen Regionen, zuverlässig zu sichern. Deshalb haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart, den Ländern hierfür Spielräume zu eröffnen und erweiterte Kooperationen zu ermöglichen. Aber Ausnahmeregelungen dürfen nicht dazu führen, dass notwendige Strukturreformen aufgeschoben oder die Versorgungsqualität gefährdet werden.
Simone Borchardt: Genau, bei der Krankenhausreform gilt: Wir dürfen den Strukturwandel nicht verwässern. Wenn jedes Bundesland nur Ausnahmen für seine Kliniken durchsetzt, verspielen wir Qualität und Wirtschaftlichkeit. Gleichzeitig müssen wir regionale Versorgung sichern. Die Balance ist entscheidend, aber wir dürfen nicht auf halbem Wege stehen bleiben.
Auch die Reform der Notfallversorgung soll nun rasch auf den Weg gebracht werden, ein entsprechendes Gesetz liegt ja schon in den Schubladen der Vorgängerregierung. An welchen Stellschrauben wollen Sie noch drehen und wie sieht es mit einer Reform des dringend reformbedürftigen Rettungsdienstes aus? Ohne Rettungsdienstreform werden sich viele (Kosten-)Probleme nicht lösen lassen, aber spielen da die Bundesländer mit?
Simone Borchardt: Die Notfallversorgung ist seit Jahren überfällig. Die geplante integrierte Leitstelle, die Patientinnen und Patienten steuert, ist ein richtiger Schritt. Aber ohne eine Reform des Rettungsdienstes wird es nicht gehen. Hier sind die Länder gefordert, weil der Rettungsdienst in ihrer Zuständigkeit liegt. Wir werden hier das Gespräch suchen, denn die Kosten laufen davon und die Schnittstellenprobleme gefährden Patientinnen und Patienten.
Dr. Christos Pantazis: Unser Ziel ist es, Patientinnen und Patienten im Akutfall schnell und zielgerichtet ohne Umwege und Doppelstrukturen die richtige Behandlung zukommen zu lassen. Dazu gehören eine bessere Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung, die Stärkung Integrierter Notfallzentren sowie eine moderne, digitale Patientensteuerung. Neben dieser überfälligen Notfallreform braucht es die schon erwähnte grundlegende Reform des Rettungsdienstes. Bund und Länder müssen an einem Strang ziehen, damit wir bundesweit einheitliche Qualitätsstandards schaffen, Kosten effizienter steuern und die Versorgung für die Menschen zuverlässig sichern können.
Die Koalition will ein Primärarztsystem einführen. Was versprechen Sie sich davon? Schafft man nicht neue Versorgungsprobleme oder einen Flaschenhals, wenn künftig alle Patientinnen und Patienten erst die Hausärztin oder den Hausarzt aufsuchen müssen? Braucht es da nicht flexiblere Modelle?
Dr. Christos Pantazis: Das Primärarztsystem ist ein wichtiger Baustein, um die Versorgung in Deutschland effizienter und patientenorientierter zu gestalten. Wenn Hausärztinnen und Hausärzte künftig stärker als Lotsen durch das Gesundheitssystem fungieren, erhalten Patientinnen und Patienten eine bessere Orientierung, Wartezeiten können verkürzt und Ressourcen gezielter eingesetzt werden. Wichtig ist mir, dass das Primärarztsystem so ausgestaltet wird, dass es für die Patientinnen und Patienten spürbare Vorteile bringt. Nur wenn das Modell überzeugt, wird es auch breite Akzeptanz finden.
Simone Borchardt: Das Primärarztsystem soll Orientierung und Steuerung geben. Heute verirren sich viele Patientinnen und Patienten im „Selbstbedienungsladen“ des Systems. Hausärztinnen und Hausärzte sind Lotsen, die die Versorgung steuern. Wir brauchen aber flexible Modelle: In Regionen mit Ärztemangel müssen auch digitale Zugänge und multiprofessionelle Teams eine Rolle spielen.
Zum zweitgrößten Ausgabenblock in der GKV haben sich die Arzneimittelausgaben entwickelt, die Ausgaben steigen zum Teil exorbitant. Eine wesentliche Ursache dafür ist, dass vor allem bei Markteinführung neuer Arzneimittel immer höhere Preise von den Herstellern verlangt werden. Wie kann gegengesteuert werden, damit auch in Zukunft Innovationen finanzierbar bleiben?
Simone Borchardt: Arzneimittelausgaben sind ein wachsendes Problem, welches wir eng beobachten. Fest steht allerdings: Wir wollen Innovation, wir brauchen Innovationen. Deshalb müssen wir uns der Thematik systematisch nähern. Die Herausforderung wird es werden, die Balance zwischen Wirtschaftlichkeit und Kosten zu gewährleisten. Gleichzeitig brauchen wir ebenfalls neue Erstattungsmodelle, die sich an tatsächlichem Nutzen orientieren.
Dr. Christos Pantazis: Das AMNOG-Verfahren hat sich bewährt und ist ein Erfolgsmodell, das wir nicht infrage stellen. Gleichwohl müssen wir bei hochinnovativen und oft sehr teuren Therapien eine faire Balance finden: Patientinnen und Patienten sollen schnellen Zugang zu Innovationen erhalten, gleichzeitig müssen die Preise bezahlbar bleiben. Für uns in der SPD-Bundestagsfraktion ist klar: Die Sicherheit der Arzneimittelversorgung, verlässliche Rahmenbedingungen für die pharmazeutische Industrie und die nachhaltige Finanzierbarkeit der GKV müssen Hand in Hand gehen.
Wie gehen Sie mit dem Gutachten zu Arzneimittelpreisen des Sachverständigenrats Gesundheit & Pflege um, der ja wegweisende Reformvorschläge eingebracht hat?
Dr. Christos Pantazis: Es liefert wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der Arzneimittelpreisbildung in Deutschland. Wir werden die Vorschläge des Rates, insbesondere zur Weiterentwicklung des AMNOG-Verfahrens und zur Stärkung der Nutzenbewertung, sorgfältig prüfen und in den politischen Prozess einbeziehen. Sicherheit in der Arzneimittelversorgung, verlässliche Rahmenbedingungen für die forschende Industrie und die nachhaltige Finanzierbarkeit unseres Gesundheitssystems müssen im Gleichgewicht stehen – das ist für uns als SPD handlungsleitend.
Simone Borchardt: Konkrete Vorschläge wie das Gutachten des Sachverständigenrats halten der Politik gerne den Spiegel vor. Besonders wichtig finde ich, die Empfehlungen zu prüfen und konkrete Handlungsaufträge daraus zu ziehen. Wir werden prüfen, welche Vorschläge kurzfristig umgesetzt werden können, ohne den Forschungsstandort Deutschland zu schwächen.
Wo sehen Sie persönlich noch großen Handlungsbedarf, was ist Ihr Steckenpferd?
Simone Borchardt: Mein persönliches Anliegen ist die sektorenübergreifende Versorgung. Die Trennung zwischen ambulanter und stationärer Medizin ist nicht mehr zeitgemäß. Wir brauchen integrierte Versorgungszentren, digitale Steuerung und ein System, das Patientinnen und Patienten von der ersten Anlaufstelle bis zur Nachsorge begleitet. Nur so gewinnen wir Effizienz und Qualität gleichermaßen.
Dr. Christos Pantazis: Mein Leitmotiv ist, die Qualität der Versorgung zu sichern und zu verbessern, die Belastungen für die Beitragszahlerinnen und -zahler im Rahmen zu halten und zugleich den medizinischen Fortschritt für alle Menschen zugänglich zu machen. Gesundheitspolitik bedeutet Verantwortung für die ganze Gesellschaft und ich bin überzeugt: Wenn wir diese Aufgaben gemeinsam mit allen Partnern im Gesundheitswesen anpacken, können wir unser solidarisches System nachhaltig stärken.
Weitere Artikel aus ersatzkasse magazin. (5. Ausgabe 2025)
-
 BEEP und Pflegefachassistenzausbildung
BEEP und PflegefachassistenzausbildungAktuelle Gesetzgebung: Pflege stärken, Bürokratie bremsen?















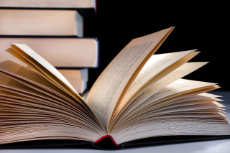
 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026
Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026
Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


