Der Deutsche Ethikrat ist ein interdisziplinär zusammengesetztes, unabhängiges Beratungsgremium, das sich 2008 als Nachfolgegremium des Nationalen Ethikrats gebildet hat. Er setzt sich mit ethischen, gesellschaftlichen, naturwissenschaftlichen, medizinischen und rechtlichen Fragen sowie den Auswirkungen auf Individuum und Gesellschaft auseinander. Der Jurist Prof. Dr. Steffen Augsberg ist Mitglied des Deutschen Ethikrats. Im Interview mit ersatzkasse magazin. wirft er einen Blick auf die Herausforderungen für die Gesellschaft und das Gesundheitswesen im Zuge der Corona-Pandemie, auf die von der Politik getroffenen Maßnahmen sowie die ethischen Aspekte, die jeden Einzelnen betreffen.

Herr Prof. Dr. Augsberg, seit Wochen hält die Corona-Pandemie Deutschland und den Rest der Welt in Schach. Inwieweit ist der Deutsche Ethikrat darauf vorbereitet gewesen? Hat es etwas Vergleichbares seit Bestehen des Deutschen Ethikrats schon einmal gegeben?
Steffen Augsberg: Eine solche umfassende, alle Gesellschaftsschichten und nahezu jeden Einzelnen – national wie international – betreffende Krise haben wir natürlich noch nicht erlebt. Für den Ethikrat ist damit eine spezielle Herausforderung verbunden: Typischerweise arbeiten wir eher antizipierend und schreiben längere Texte zu Problemen, die mittel- bis langfristig zu lösen sind. Jetzt haben wir selbst das Bedürfnis gesehen, schneller und punktueller zu (re)agieren, und wir sind hierum wiederholt durch die Politik gebeten worden. Anlassbezogene Ad-hoc-Empfehlungen gab es zwar schon früher, aber in der Krise werden sie wichtiger.
Der Deutsche Ethikrat hat sich schon früh seit Ausbruch der Corona-Pandemie für Solidarität und Verantwortung ausgesprochen. Werte, die in so einer Situation besonders zum Tragen kommen?
Ja, aber auch Werte, die jetzt besonders prekär sind. Wir haben frühzeitig erklärt, dass die bewundernswerte und keineswegs selbstverständliche Solidarität, die gerade zu Beginn der Krise zu beobachten war, keine unendliche Ressource ist. Deshalb ist Augenmaß bei Beschränkungen nicht nur ein Freiheits-, sondern auch ein Solidaritätsgebot. Ähnliches gilt für die Verantwortung. Sie betrifft unterschiedliche Akteure und ihr Zusammenwirken, darf aber nicht einfach unterstellt werden, sondern muss reflektiert und gegebenenfalls eingefordert werden.
Die Politik hätte noch stärker den Dialog mit den Bürgern suchen können.
Wie fällt Ihre bisherige Bilanz zum Umgang der Politik mit der Corona-Pandemie aus? Was ist gut gelaufen und woran üben Sie Kritik?
Wir wissen nach wie vor zu wenig über Ursachen und Folgen von Covid-19. Aus dieser Unsicherheit resultieren Beurteilungsprobleme. Aber selbst wenn im Nachhinein erkannt wird, dass Beschränkungsmaßnahmen unverhältnismäßig waren, bedeutet das nicht, dass sie nicht zu Beginn – im Sinne eines Vorsichtsarguments – berechtigt waren. Hier zeigt sich, wie wichtig es ist, den Status quo immer wieder infrage zu stellen. Deshalb sind auch partielle, wenn man so will experimentelle, Öffnungen sinnvoll. Hier wurden sicher die Möglichkeiten, die der Föderalismus bietet, nicht hinreichend genutzt. Stattdessen wurde zu stark auf eine – kompetenziell nicht vorgesehene – zentrale Steuerung durch die Bundesregierung gesetzt. Vorteilhaft wäre es auch gewesen, anstelle einer bisweilen unklaren und zudem variierenden Zahlenfixiertheit früher materielle und verfahrensbezogene Kriterien zu entwickeln, um Wege aus dem Lockdown aufzuzeigen. Dabei hätte die Politik noch stärker den Dialog mit den Bürgern suchen können. Nicht nur, um Akzeptanz zu erhöhen, sondern auch, um das in der Gesellschaft vorhandene Innovationspotenzial zu erschließen.
Minimierung der Kontakte, Abstandsregelungen, Schließungen von Kitas und Schulen, Sportstätten, Geschäften und vieles mehr – wie ordnen Sie die bislang getroffenen politischen Maßnahmen und Entscheidungen aus ethischer Sicht ein? Und wann stößt die Gesellschaft an ihre Belastungsgrenze?
Mir erscheinen hier zwei teilweise widersprüchliche Aspekte besonders hervorhebenswert: Erstens gab und gibt es in der Politik das erkennbare Bemühen, einheitliche und dauerhafte Lösungen zu präsentieren. Daher rührt wohl auch der anfängliche Widerwillen gegenüber regionalen Differenzierungen. Im Grunde ist das aber eine von vornherein schwierige, um nicht zu sagen illusorische Vorstellung. Es wäre besser gewesen, den Bürgern zu erklären, dass das unvollständige, aber sich verändernde und verbessernde Wissen Anpassungen verlangt und dass das kein Scheitern bedeutet, sondern zum notwendig tastenden Vorgehen gehört. Zweitens fehlt aber eine Regelungskohärenz. Wann und warum bestimmte Beschränkungsmaßnahmen eingeführt bzw. wieder gelockert wurden, ist oft schwer verständlich. Bisweilen kann man sich kaum des Eindrucks erwehren, lautstarke, gut organisierte Gruppen würden gegenüber stilleren, aber nicht minder belasteten bevorzugt. Das gefährdet unter anderem auch die Regelungsakzeptanz und die Mitwirkungsbereitschaft der Bevölkerung.
Die Gesundheitsversorgung sicherzustellen und gleichzeitig die Bevölkerung nicht mit Maßnahmen zu überfordern, haben Sie als ethischen Basiskonflikt beschrieben. Hat in der Coronakrise eine gerechte Abwägung zwischen den konkurrierenden moralischen Gütern stattgefunden?
Alles in allem können wir zufrieden sein. Es ist gelungen, einerseits die schlimmsten Be- und Überlastungsszenarien, insbesondere im Gesundheitssystem, zu vermeiden, und andererseits nicht so weitgehende Freiheitsbegrenzungen vorzunehmen, wie das in einigen Nachbarländern für erforderlich erachtet wurde. Missglückt war sicherlich die Handhabung der Masken: Hier hätte früher auf deren (wenngleich begrenzten) Schutzeffekt gesetzt werden sollen. Das hätte geholfen, weiterreichende Einschränkungen zu vermeiden. Ob man ansonsten noch großzügiger hätte sein können, etwa mit Blick auf Kitas, Kindergärten und Schulen, wird noch zu debattieren sein, und dabei spielen dann natürlich auch die Erfahrungen aus anderen Staaten eine Rolle. Im Nachhinein ist man aber, wie gesagt, immer schlauer.
Unsere Gesellschaft braucht Widerstandsgeist.
Was entgegnen Sie den Verschwörungstheoretikern oder den Menschen, die an Hygiene-Demos teilnehmen, um ihren Protest an den Einschränkungen zu zeigen? Ist die Corona-Pandemie eine Belastungsprobe für die Demokratie?
Das Schwarz-weiß-Denken ist schwierig. Und zwar nicht nur aufseiten der Demonstranten, sondern auch ihnen gegenüber. Natürlich gibt es hochproblematische Verhaltensweisen. Aber pauschale Verurteilungen und Beschimpfungen („Covidioten“) sind ebenfalls bedenklich. Zu protestieren ist legitim, in gewisser Hinsicht angesichts der massiven Freiheitsbeschränkungen sogar naheliegend und normal. Es wäre doch ein eigenartiges Untertanentum, das alles schlicht hinzunehmen. Unsere Gesellschaft braucht Widerstandsgeist, selbst heftigen Widerspruch. Eine rechtsstaatlich verfasste Demokratie misstraut auch der Mehrheit. Die Meinungs- und Versammlungsfreiheit, Grundrechte insgesamt, schützen zu Recht primär nicht die, die mit dem, sondern die, die gegen den Strom schwimmen. Wenn man sich das vor Augen hält, muss man um unsere Demokratie keine Angst haben. Wir haben eher zu wenig als zu viel Pluralismus, und die überschießenden Effekte halten wir aus.
Wie nehmen Sie den Umgang mit der Corona-Pandemie im globalen Kontext wahr? Wo lauern die Gefahren, wo sehen Sie Vorbilder?
Hier gibt es erst recht massive Unklarheiten, insbesondere mit Hinblick auf die Schwellenländer und den sogenannten Globalen Süden. Es steht zu befürchten, dass dort die schlimmsten Folgen noch ausstehen. Neue Spannungen, etwa im Verhältnis USA/China, sind ja auch bereits zu beobachten. Sorgen bereitet mir ferner, wie sich die beginnende weltweite Rezession, die schon bei uns schwer genug zu ertragen sein wird, auf die ärmeren Länder auswirkt. Positiv ist aber der zu beobachtende besondere Zusammenhalt, weil wir intensiver kommunizieren, stärker aufeinander achten und bereit sind, voneinander zu lernen.
Personen, die Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus aufweisen oder Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatten, werden unter eine 14-tägige Quarantäne gestellt. Wie lässt sich das mit Blick auf die Einschränkung der Persönlichkeitsrechte rechtfertigen, wo liegt hier die rote Linie?
Beschränkungen gegenüber Personen, die auf-grund der genannten oder anderer Faktoren nachweislich ein erhöhtes Gesundheitsrisiko darstellen, sind relativ unproblematisch zu legitimieren. Schwieriger ist es, wenn es trotz des beim Einzelnen statistisch verschwindend geringen Risikos zu einem umfassenden, alle erfassenden Lockdown kommt, der in unzähligen Fällen individuell desaströse Folgen hat. Das kann man nur pragmatisch rechtfertigen, weil es nicht möglich ist, die Gefährdungsszenarien konkreter zu untersuchen, und deshalb ein effektiver Infektionsschutz eine Art „Generalverdacht“ erlaubt und verlangt. Offenkundig ist das aber ein problematisches Vorgehen, da in den allermeisten Fällen eben gerade keine tatsächliche Gefahr vorliegt. Das erklärt letztlich auch die aktuellen Debatten um den „Immunitätsausweis“: Wer nachweislich weder sich noch andere gefährdet, entzieht sich dieser Begrenzungslogik. Hier muss also, wenn bestehende Beschränkungen dennoch aufrechterhalten werden sollen, eine alternative, mindestens ebenso gewichtige Begründung erfolgen.
Apps zur digitalen Nachverfolgung von Infektionsketten sind auf dem Vormarsch. Wie bewerten Sie die Datenschutzfrage – und ist eine Aushebelung des Prinzips der Freiwilligkeit möglich?
Es ist zumindest erstaunlich, dass wir einerseits bei zahlreichen anderen, keinesfalls weniger wichtigen Grundrechten zu vorbildlos weitgehenden und umfassenden Beschränkungen bereit sind, andererseits aber viele meinen, der Datenschutz müsse auch in der Krise uneingeschränkt gewährleistet sein. Ob wir das Freiwilligkeitsprinzip antasten dürfen oder sollten, ist damit noch nicht gesagt. Aber es gibt ein legitimes Interesse daran, Infektionswege möglichst rasch und genau nachvollziehen zu können.
Kommen wir zur Triage – also der ärztlichen Entscheidung, bei welchen Patienten sich angesichts knapper medizinischer Ressourcen eine Behandlung lohnt. Können Sie den schwierigen Konflikt für Ärzte bei der Beurteilung von Covid-19-Patienten beschreiben? Während in Deutschland dieses Schreckensszenario ausgeblieben ist, stieß das italienische Gesundheitswesen an genau diese Grenzen.
Der Begriff Triage umschreibt ein Verteilungsverfahren, wenn überlebenswichtige Ressourcen nicht für alle, die sie benötigen, vorhanden sind. Das sind tragische Entscheidungen. Wir haben in Deutschland erstens Glück gehabt, dass uns die Krise erst mit Verzögerung erreicht hat und wir deshalb mehr Vorbereitungszeit hatten. Zweitens war das Gesundheitssystem besser aufgestellt als in einigen Nachbarländern. Drittens ist es durch Beschränkungsmaßnahmen gelungen, die Zahl der zu Versorgenden auf einem handhabbaren Niveau zu halten. Anderenfalls hätten wir schwer auszuhaltende Situationen erlebt – auch, weil eine Spannung besteht zwischen der auf der Gleichheit aller Menschen basierenden Rechtsordnung und hiervon unter Umständen abweichender moralischer Intuition und Reflexion.
Viele Teilkonflikte sind im Verlauf der Krise sichtbar geworden, zum Beispiel die Frage danach, wer Unterstützung aus den Rettungsschirmen erhält. Was ist zum Wohle aller gerecht, sinnvoll, zumutbar und ethisch vertretbar?
Das ist so abstrakt kaum zu bestimmen. Die Unterstützungsmaßnahmen zielen ja vor allem darauf, schlimmere Folgen zu verhindern. Man kann allerdings bei einigen Branchen die Frage stellen, ob die Krise nicht einen allgemeinen Niedergang nur verstärkt oder vorwegnimmt. Ich denke hier an Reisebüros, aber auch, für Deutschland besonders schwierig, die zuletzt bereits gebeutelte Autoindustrie. Ähnliche Bedenken stellen sich im Übrigen mit Blick auf die Unterstützung strukturell problematischer Volkswirtschaften.
Wie bewerten Sie den Umgang mit Medizinern und insbesondere Pflegekräften, die schon lange bessere Arbeitsbedingungen und mehr Wertschätzung fordern? Glauben Sie, diese Belastungsprobe schafft mehr Anerkennung in der Zukunft?
Mediziner können sich über eine unzulängliche gesellschaftliche Wertschätzung nicht beklagen und ihre Arbeitsbedingungen wurden in den vergangenen Jahren signifikant verbessert. Für die Pflegekräfte gilt das so nicht. Größere Veränderungen sind aber leider angesichts der weiterhin bestehenden Sachzwänge kaum zu erwarten. Wir erfahren ja nicht erst jetzt, wie wichtig diese Berufe sind, und dennoch ist bislang wenig passiert.
Ende März 2020 stellte der Deutsche Ethikrat Empfehlungen für eine Rückkehr in den normalen Alltag vor. Inwieweit hat die Bundesregierung die Empfehlungen des Ethikrates berücksichtigt?
Die Ad-hoc-Empfehlung sollte eine breitere gesellschaftliche Debatte über „Öffnungsperspektiven“ anstoßen. Wichtig war uns auch, zu betonen, dass politische Entscheidungsträger auf Experten hören sollten, ihnen aber nicht hörig sein dürfen. Sie müssen zahlreiche Stimmen und Positionen berücksichtigen. Dessen eingedenk meine ich schon, dass wir mit unseren Sachargumenten Gehör gefunden haben.
Ist eine Rückkehr zum gesellschaftlichen Leben, wie wir es vor Corona kannten, noch denkbar?
Zunächst wird der Sommer den Eindruck zurückgewonnener Normalität verstärken. Im Freien kann man sich einfach viel unbesorgter verhalten. Das Leben nach der Krise wird dennoch anders sein. Vieles, was selbstverständlich war, wird nicht einfach so wieder zur unhinterfragten Routine werden. Manches wird dauerhaft mit einem schlechten Gefühl belastet sein. Die Re-Normalisierung wird in unterschiedlichen Lebensbereichen sehr unterschiedlich erfolgen.
Denken Sie, dass die Coronakrise auch eine Chance für die Gesellschaft ist? Im Hinblick etwa auf die Themenfelder Klimaschutz, Digitalisierung, Mobilität?
Auch das ist differenziert zu betrachten. Einiges wird einfacher, anderes deutlich schwieriger werden. Das zeigen die genannten Themenfelder: Der Klimaschutz steht vor dem Problem, dass durch die Wirtschaftskrise die Handlungsspielräume deutlich kleiner werden. Die unter Klimaschutzaspekten eingeforderte reduzierte Mobilität wurde krisenbedingt erreicht; andererseits stieg die Bedeutung des Individualverkehrs im Vergleich zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Dank der Digitalisierung funktioniert vieles auch ohne persönliche Anwesenheit. Ob dieser Effekt von Dauer ist oder relativ schnell wieder abnimmt, ist offen. Allgemein sollten wir die Erfahrungen der Krise nutzen, um über grundlegende normative Fragen unserer Gesellschaft, etwa den Sinn absoluter Grenzen, die sachliche, personelle und territoriale Reichweite von Solidarität, ihr Verhältnis zu Gerechtigkeitsforderungen, die individuelle und kollektive Risikobereitschaft (oder -aversion), weiter nachzudenken.

Der Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Steffen Augsberg ist seit 2016 Mitglied des Deutschen Ethikrats. Zu seinen Schwerpunkten zählt dort die übergreifende Betrachtung von verfassungsrechtlichen, demokratietheoretischen und ethischen Fragestellungen. Er war unter anderem Sprecher der Arbeitsgruppe „Big Data“, der Arbeitsgruppe „Tierwohlachtung“ und der Arbeitsgruppe „Solidarität und Verantwortung in der Coronakrise“. Seit April 2013 hat er die Professur für Öffentliches Recht an der Justus-Liebig-Universität Gießen inne. Der am 13. September 1976 geborene Jurist studierte von 1995 bis 2000 Rechtswissenschaft an den Universitäten Trier und München. Es folgten die Promotion zum Dr. iur. an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (2002) und die Habilitation an der Universität zu Köln (2011). Von 2011 bis 2013 war er Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, insbesondere Recht des Gesundheitswesens, an der Universität des Saarlandes.








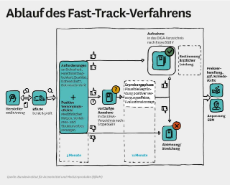


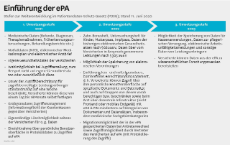


 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2025
Landesbasisfallwerte 2025 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2025
Beitragsbemessungs- grenzen und Beitragssätze 2025 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


