Mit seiner Initiative „Gesundheit einfach machen – Gesundheitsförderung in Werk- und Wohnstätten gestalten“ unterstützt der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) die Ausarbeitung eines gesundheitsförderndes Fachberatungsprozesses in Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Begleitet wird dieses Forschungs- und Entwicklungsprojekt durch eine Evaluation – unter aktiver Beteiligung von Menschen mit Behinderung.

Mit der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN) hat es 2006 einen Paradigmenwechsel in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung gegeben. Ihr Inkrafttreten bedeutete gleichberechtigte Teilhabe und soziale Inklusion von Menschen mit Behinderung. Für Projekte der Gesundheitsförderung bedeutet diese Anforderung eigentlich keine Hürde, allerdings bestehen noch Vorbehalte zur richtigen Einbeziehung von Menschen mit Behinderung, insbesondere wenn es um Menschen mit Lernschwierigkeiten geht. Gesundheitserziehung in einfacher Sprache scheint das Maximum zu sein – sie in die Prozesse gesundheitsförderlicher Organisationsentwicklung einzubeziehen, wird manchmal als zu komplex bewertet. Die Vorstellung, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten aktiv in den Evaluationsprozess einbezogen werden, scheint abwegig.
Allerdings: Erfahrungen aus der Evaluation des Projekts „Gesundheit einfach machen – Gesundheitsförderung in Wohn- und Werkstätten für Menschen mit Behinderung“ zeigen, dass es weniger die Menschen mit Behinderung sind, die behindern, sondern die Vorstellungen und Methoden der Evaluation. Es stellte sich heraus, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten sehr wohl Organisationsentwicklungsprozesse mitgestalten können. Aus dieser „inklusiven Evaluation“ lassen sich Lernprozesse und Erkenntnisse ableiten. Im Mittelpunkt der sozialen Inklusion steht die Überlegung: „Was kann ich machen, damit alle in den Evaluationsprozess eingebunden sind?“
Im Projekt „Gesundheit einfach machen“ des vdek im Namen und Auftrag der Ersatzkassen entwickelte die Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin (KHSB) einen Fachberatungsprozess zur Umsetzung des Gesundheitsförderungsprozesses in Wohn- und Werkstätten für Menschen mit Behinderung gemäß dem „Leitfaden Prävention“ und pilotierte diesen in drei Einrichtungen. Dazu werden in den jeweiligen Einrichtungen eine Gesundheitskoordination und ein Gesundheitsteam eingesetzt. Die Gesundheitskoordination steuert den gesamten Prozess, das Gesundheitsteam diskutiert und entscheidet in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung die Schritte und Maßnahmen der Organisationsentwicklung. Das Besondere dieses Vorgehens ist die inklusive Besetzung der Gesundheitskoordination und des Gesundheitsteams. Nach dem Aufbau dieser Strukturen wird der Gesundheitsförderungsprozess mit den Phasen Analyse, Planung, Implementierung und Evaluation durchlaufen.
Für die Evaluation des Projekts wird zunächst ein Evaluationsdesign entwickelt. Dabei sollen neben Fragebögen und Gruppendiskussionen auch Workshops durchgeführt werden, um die Evaluation inklusiv und partizipativ zu gestalten. Mit einem Gesundheitsfragebogen in einfacher Sprache wird eine Ist-Analyse durchgeführt. Die Daten dieser Ist-Analyse nutzt das Gesundheitsteam als Planungsgrundlage. Verständnisschwierigkeiten gibt es dabei keine – im Gegenteil hilft die Diskussion der Ergebnisse im Gesundheitsteam bei der Einordnung in den Einrichtungsalltag. In Fokusgruppen diskutiert das Gesundheitsteam über die Ziele des Gesundheitsprojekts. Eine Tiefenanalyse zeigt, dass je inklusiver die Diskussionskultur in den Gruppen ist, desto reichhaltiger die Antworten aller Beteiligten sind. In diesen Fokusgruppen stellen häufig zunächst Menschen ohne Behinderung ihre Perspektiven dar und eröffnen einen Antworthorizont, der es Menschen mit Behinderung erlaubt, sich darauf zu beziehen, aber auch ihre eigenen Sichtweisen hinzuzufügen – ein Phänomen, das generell aus Fokusgruppen bekannt ist.
Selbst Formate wie partizipative Workshops zur Entwicklung konkreter Maßnahmenziele können in inklusiven Teams erfolgreich umgesetzt werden. In einer Werkstatt wurden zum Beispiel bewegte Pausen als Maßnahme geplant. Beim Workshop konnten gemeinsam Ziele sowie Indikatoren entwickelt werden, an denen zu erkennen ist, ob die Maßnahme ein Erfolg ist. Auf Grundlage der eigenen Lebensweltexpertise wird gemeinsam bewertet, wie realistisch Zielvorstellungen sind (beispielsweise wie bewegte Pausen in den jeweiligen Abteilungen und Bereichen umgesetzt werden können). Für die Evaluation ist es dabei zentral, in der Sprache einfach zu bleiben. Aber auch dies gilt für alle Zielgruppen.
Eine wichtige Erkenntnis ist, dass inklusive Evaluation gelernt werden muss. Dort, wo Menschen mit Lernschwierigkeiten zum Beispiel Erfahrung in der Arbeit als Werkstattrat haben und Inklusion in der Organisation gelebte Wirklichkeit ist, bringen sie sich von Beginn an ein. Dort, wo das unbekannt und noch keine gelebte Praxis ist, braucht es Zeit. Was benötigt wird, damit alle mitgestalten können, ist nicht nur eine ethische Frage, sondern auch eine Frage nach der Qualität. Was im Leben und in der Gesundheitsgestaltung wichtig ist, ist sehr genau bekannt und wird auch zum Ausdruck gebracht, man muss nur richtig fragen.




















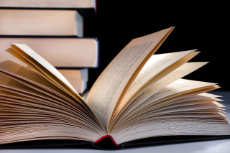
 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026
Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026
Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


