Prävention und Gesundheitsförderung sind wichtige Säulen der Versorgung. Prof. Dr. Stefan Willich ist Direktor des Instituts für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie der Charité in Berlin. Im Interview zeigt er auf, wo Deutschland in Sachen Prävention Nachholbedarf hat, woran sich Erfolge von Gesundheitsförderung zeigen und wie die Politik gefordert ist.

Wo steht Deutschland in Sachen Prävention und Gesundheitsförderung?
Prof. Dr. Stefan Willich: Hier gilt es zunächst, verschiedene Bereiche von Prävention zu unterscheiden. Es gibt die Primärprävention, mit der von vornherein Krankheit verhindert sowie das Gesundheitsverhalten einzelner Personen und der Bevölkerung insgesamt verbessert werden sollen. Sekundärprävention betrifft die möglichst frühzeitige Diagnose von Krankheiten, etwa mithilfe von Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung, wer Krankheitsrisiken oder bereits eine Erkrankung hat. Und mit Tertiärprävention ist die Verhinderung oder zumindest Verzögerung von erneutem Krankheitsgeschehen gemeint – in Deutschland durch den Rehabilitationsbereich seit Langem relativ gut entwickelt. Was aber in Deutschland ganz miserabel entwickelt ist und eigentlich kaum existent, sind Primärprävention und Gesundheitsförderung. Im internationalen Vergleich sind wir sozusagen „Entwicklungsland“, ganz anders als in der Akuttherapie, wo Deutschland international mit führend ist.
Woran liegt das?
Die Primärprävention hat viel mit Lebensstil zu tun, sowohl mit individuellem Lebensstil als auch mit den Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems und der Gesundheitspolitik. Damit sind wir bei weiteren Begrifflichkeiten, nämlich Verhaltens- und Verhältnisprävention. Verhaltensprävention betrifft, wie der Name schon sagt, das Verhalten einzelner Personen, beispielsweise Ernährung und körperliche Aktivität. Verhältnisprävention betrifft die gesundheitspolitischen Verhältnisse und Regelungen, zum Beispiel Rauchverbot in öffentlichen um Risiken von Passivrauchen zu vermeiden. Längst überfällig wäre auch ein Verbot oder zumindest eine Einschränkung von süßigkeitshaltigen Getränken – Stichwort Zuckersteuer – zur Vermeidung beziehungsweise Reduktion von Diabetes-Mellitus-Erkrankungen. Es ist beschämend, wie weit hinten Deutschland da im internationalen Vergleich liegt. Was ist hierfür der Grund? Wir haben uns an eine „Allround-Versorgung“ gewöhnt, und offenbar das Gefühl, der Staat sei im Ernstfall für uns da ist und könne gesundheitliche Probleme wieder korrigieren. Das ist aber eine Illusion, gerade im Falle von Diabetes, Schlaganfällen und Herzinfarkten. Diese Erkrankungen stellen für die Betroffenen eine Katastrophe dar, die nicht mehr zu korrigieren ist, oft aber hätte verhindert werden können, wenn man zehn, 20 Jahre zuvor die gesundheitlichen Weichen anders gestellt hätte. Ein weiterer Grund sind Lobby-Interessen, so wehrt sich etwa die Nahrungsmittelindustrie vehement gegen bestimmte Regulierungs- und Besteuerungsmaßnahmen. Auch in der pharmazeutischen Industrie oder medizinischen Geräteindustrie wird man kaum Freunde und Befürworter der Primärprävention finden. Politik müsste mehr Rückgrat zeigen.
Wen sehen Sie neben der Politik in der Verantwortung?
Arbeitgeber und Krankenkassen haben eine wichtige Rolle und Funktion. Betriebliches Gesundheitsmanagement gab es bis vor wenigen Jahren nicht, inzwischen greifen moderne Unternehmen und Organisationen dieses Thema auf und kümmern sich um die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden, zum Beispiel in Form gesunder Arbeitsplatzbedingungen oder durch Präventionskurse, die von vielen Krankenkassen bezuschusst werden. Allerdings erscheinen die Möglichkeiten der Krankenkassen mit Blick auf die Finanzierung von Prävention begrenzt.
Den gesetzlichen Krankenkassen stehen in diesem Jahr rund 186 Millionen Euro für Präventionsleistungen zur Verfügung. Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) insgesamt lagen im vergangenen Jahr bei über 300 Milliarden Euro.
Dieser Präventionstopf der GKV ist viel zu klein. Für Gesundheitsausgaben steht ein Budget in Höhe von fast 500 Milliarden Euro pro Jahr zur Verfügung (einschließlich Leistungen der gesetzlichen und privaten Krankenkassen, Pflege-, Unfall- und Rentenversicherungen, privater und öffentlicher Haushalte, Arbeitgeber), womit Deutschland im europäischen Vergleich einen Spitzenplatz einnimmt. Aber das zahlt sich nicht aus, weil die Mittel teilweise falsch investiert werden. Wenn Sie die Ausgabensumme aufsplitten in die Ausgaben der einzelnen Bereiche, dann entfallen auf Prävention und Gesundheitsförderung nur 2 bis 3 Prozent – ein geringfügiger Anteil. Es müsste viel mehr in Prävention investiert werden.
Prävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine Aufgabe der allgemeinen Gesundheitsfürsorge. Nicht alles können die Beitragszahlenden der GKV schultern. Was leistet der Staat in diesem Bereich und wo sehen Sie eine faire Aufgaben- und Finanzierungsverteilung?
Der Staat ist nicht für Finanzierung von Prävention und Gesundheitsförderung verantwortlich, wohl aber für entsprechende Regelungen und gesetzliche Grundlagen. Ausgaben im Gesundheitsbereich müssen umverteilt werden, beispielsweise im Rahmen der aktuellen Krankenhausreform zugunsten von präventiven Leistungen. Auch stimmen die Anreizsysteme bei ärztlicher Vergütung nicht und präventive Gesprächsleistungen müssten besser honoriert werden.
Wie lassen sich Erfolge messen?
Lebenserwartung ist das härteste Erfolgskriterium, sie hängt stark von schwerwiegenden Krankheiten ab wie beispielsweise Herz-Kreislauf- oder Krebserkrankungen. Ziel einer guten Prävention und Gesundheitsförderung ist es, Krankheiten zu vermeiden oder zumindest verzögern, um ein möglichst langes krankheitsfreies Leben zu ermöglichen.
Was machen andere Länder anders?
Vor allem die skandinavischen Länder investieren seit Jahrzehnten auf hohem Niveau in Prävention und Gesundheitsförderung und konnten durch verändertes Gesundheitsverhalten und Lebensstil die Sterblichkeit durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen erheblich senken. Besonders eindrucksvoll in Finnland – vor 50 Jahren noch weltweit an der Spitze der Herz-Kreislauf-Sterblichkeit –, wo multimodale Community-basierte Lebensstilveränderungen erreicht wurden, im Zusammenwirken mit Patientinnen und Patienten, Familien, Freunden, Gesundheitsberufen, Verbänden, Nahrungsmittelunternehmen, Restaurants, Schulen, Kindergärten, Arbeitgebern und anderen Organisationen.
Die Politik hat sich der Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit dem Gesundes-Herz-Gesetz angenommen, das allerdings nach dem Aus der Koalition erstmal vom Tisch ist.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Deutschland und vielen anderen Industrienationen die Haupttodesursache, etwa ein Drittel aller Todesfälle hierzulande sind bedingt durch Herzinfarkte, Schlaganfälle oder plötzlichem Herztod. Daher ist es gut, dass die Politik endlich beginnt, diese Themen ernsthaft ins Visier zu nehmen. Allerdings ist das auch das einzig Gute an dem aktuellen Gesetzentwurf. Aus meiner Sicht ist dieser falsch angelegt insofern, als nur wenige isolierte Aspekte der Prävention adressiert werden, einschließlich Früherkennung und Therapie im Fettstoffwechselbereich und medikamentöse Therapie bei Raucherinnen und Rauchern. Beides mag für eine kleine Zielgruppe seine Berechtigung haben, aber der Gesetzentwurf wird das Ziel einer effektiven Prävention und Gesundheitsförderung verfehlen. Zumal die Finanzierung aus dem Präventionstopf der gesetzlichen Krankenkassen erfolgen soll, der wie gesagt sowieso zu klein ist.
Anstelle von vorbeugendem Handeln sollten unter anderem Medikamente zur Tabakentwöhnung finanziert werden.
Es gibt durchaus medikamentöse Ansätze, die sich anhand wissenschaftlicher Studien als erfolgreich erwiesen haben. Und einer bestimmten Hochrisikogruppe von Raucherinnen und Rauchern sollte man diese Medikation auch zur Verfügung stellen und finanzieren, da kann sie sinnvoll sein. Das darf aber nicht vom Hauptziel ablenken, dass die Menschen erst gar nicht anfangen zu rauchen. Insbesondere im Kinder- und Jugendalter ist es vornehmlich wichtig, das Rauchen zu verhindern, genauso wie übrigens auch hinsichtlich Ernährung die Weichen schon im frühen Alter gestellt werden. Medikamentöse Therapie sollte erst dann genutzt werden, wenn die konventionellen Therapien für Raucherentwöhnung nicht gefruchtet haben, vor allem individuelles Verhalten mit entsprechender Unterstützung.
Welche Rolle spielen Vorsorgeuntersuchungen?
Vorsorgeuntersuchungen sind ein sehr wichtiges und wirksames Angebot, speziell zur Früherkennung von Krebserkrankungen. Allerdings ist die Inanspruchnahme noch lange nicht so gut, wie man sich es wünschen würde. Der sozioökonomische Status, der vor allem Bildung, finanzielle Mittel und berufliche Tätigkeit der einzelnen Person umfasst, hat großen Einfluss auf die Lebenserwartung insgesamt, auf Krankheitsrisiken und auch auf die Inanspruchnahme von Vorsorgemaßnahmen. Diejenigen, die schlechter gebildet und sozial schlechter gestellt sind, nehmen Vorsorge deutlich weniger in Anspruch als sozioökonomisch besser Gestellte.
Wie lässt sich das ändern?
Prävention und Gesundheitsförderung müssen eng im sozialen Kontext gedacht und organisiert werden. Darum ist es sinnvoll, Prävention vor Ort zu leben. Dazu zählt, die Gesundheitsämter besser auszustatten, denn diese sind in der Regel nah dran an den lokalen Bevölkerungsgruppen und könnten einschätzen, wie man Problempersonen am besten erreicht und anspricht. Die sogenannten Settings beziehungsweise Lebenswelten sind mit dem Präventionsgesetz 2015 stärker in den Fokus gerückt und bei Prävention geht es auch immer um die Frage, wo ich die Bürgerinnen und Bürger am besten abhole. Ein guter Einstieg für Prävention und Gesundheitsförderung bietet sich dort, wo sich Menschen sowieso aufhalten, also Kitas, Schulen, am Arbeitsplatz, in Vereinen, Verbänden. Eine große Rolle spielen auch Familie und Freundeskreis, Prävention hat auch immer etwas mit partnerschaftlicher Unterstützung zu tun.
Braucht es mehr Aufklärung?
Eine große Herausforderung der Primärprävention ist, dass positive Effekte erst längerfristig zu erwarten sind. Man muss die Menschen für etwas gewinnen, was keinen unmittelbaren Vorteil zeigt. Dies deutlich zu machen, ist eine besondere Herausforderung, und damit lässt sich auch politisch nicht „punkten“. Prävention geht weit über die übliche Legislaturperiode hinaus, und zahlt sich oft erst nach vielen Jahren oder sogar Dekaden aus. Daher muss Prävention fachlich unabhängig von Politik gestaltet werden. Angedacht ist ja ein neues Institut für Prävention, was all diese Aspekte von Prävention und Gesundheitsförderung – angefangen bei der Initiierung von Modellprojekten über Aufklärung und wissenschaftliche Evidenz bis hin zur Teilnahme großer Bevölkerungsgruppen – vorantreiben soll. Meines Erachtens ist ein solches Institut dringend notwendig, aber nicht als weitere nachgeschaltete Bundesbehörde, wie aktuell leider vorgesehen, sondern in fachlicher Unabhängigkeit.
Was wünschen Sie sich – nach der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar 2025 – von einer neuen Regierung?
Prävention muss konsequent in die Regierungsprogramme aufgenommen werden. Die bisherige Koalition hat endlich begonnen, Prävention in Deutschland weiterzuentwickeln, und diese Strategie sollte konsequent weitergehen. Wenn dies nicht passiert, wären große epidemiologische Wellen von Diabetes, Schlaganfall, Herzinfarkt zu erwarten, eine Katastrophe für die Betroffenen, das Gesundheitssystem und die Bevölkerung.




















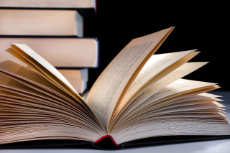
 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026
Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026
Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


