Die Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung im Jahr 1994 als fünfte Säule der deutschen Sozialversicherung ist ein Meilenstein der bundesdeutschen Sozialpolitik gewesen. In der kurz nach der Wiedervereinigung durchaus politisch und ökonomisch komplizierten Situation zeigte die seinerzeitige konservativ-liberale Koalition unter Helmut Kohl sozialpolitisches Profil. Es war nicht zuletzt die Einführung der Pflegeversicherung, die zur Wiederwahl von Helmut Kohl geführt hat. Heute ordnet die Bevölkerung der Pflege höchste Priorität zu, das zeigen aktuelle Umfragen: Die gesundheitliche und pflegerische Versorgung ist demokratierelevant.

Die Pflegeversicherung ist angetreten, um pflegebedingter Verarmung entgegenzutreten. Die überwiegende Zahl der Pflegebedürftigen sollte nicht auf Sozialhilfe verwiesen werden. Gemäß dem sozialpolitischen Credo vom Norbert Blüm heißt es in der Begründung zum Pflegeversicherungsgesetz: „Wer sein Leben lang gearbeitet hat und eine durchschnittliche Rente erworben hat, soll wegen der Kosten der Pflegebedürftigkeit nicht zum Sozialamt gehen müssen.“ Es waren auch die Kommunen, die seinerzeit durch die Sozialhilfeausgaben für die Hilfe zur Pflege belastet waren, die eine Pflegeversicherung und damit ihre finanzielle Entlastung befördert hatten. Der gewünschte Effekt trat ein: Die Zahl der sozialhilfeberechtigten (Heim-) Bewohnerinnen und (Heim-)Bewohner konnte – vorübergehend – reduziert werden.
Pflegebedürftigkeit wurde überdies als allgemeines Lebensrisiko anerkannt. Das aus der Sozialhilfe bekannte Pflegegeld wird einkommensunabhängig gewährt. Es soll die häusliche Pflegebereitschaft stabilisieren, mit privaten Pflegeaufgaben verbundene Aufwände in Teilen auffangen und die Sorgearbeit von An- und Zugehörigen, aber auch anderen Helferinnen und Helfern würdigen. Das Pflegegeld ist anders als prognostiziert immer noch die dominante Leistungsart. Einkommensschwache Haushalte nutzen es vornehmlich zur Sicherung des Lebensunterhaltes, Mittelschichtsfamilien für die Anerkennung von pflegenden An- und Zugehörigen oder für den Einkauf von Hilfen, insbesondere von osteuropäischen Haushaltshilfen (geschätzt 850.000 Live-in-Kräfte). Die flexible Nutzungsmöglichkeit macht seine Attraktivität aus und wird von der Bevölkerung für unverzichtbar gehalten. Angesichts der haushaltsökonomischen Kalküle übt das Pflegegeld auch eine nachfragesteuernde Wirkung auf die Inanspruchnahme formeller Dienste aus. Das Kalkül der Pflegeversicherung, die informelle Pflege, zumeist durch Frauen erbracht, zu stabilisieren, ist aufgegangen.
Die Pflegeversicherung folgt ordnungspolitisch – in neoliberaler Logik – der Wettbewerbsneutralität: keine Bedarfsplanung, keine bedarfsabhängige Zulassung von Diensten und Einrichtungen; der Markt soll es richten. Alle qualitätsgesicherten Einrichtungen und Dienste sind zuzulassen. Den Pflegebedürftigen sollte eine starke Stellung als Nachfrager mit Auswahloptionen zugeordnet werden. Aus Pflegebedürftigen wurden Kunden, es entstand eine Branche mit einer nicht unbeträchtlichen Investitionskraft und beträchtlichem Bestand an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Staat sparte (zunächst) viel Geld, da er nicht mehr für die Investitionsförderung zuständig war. Diese Aufgabe war den Ländern zugeordnet, die aber zum Teil nachvollziehbar auf Investitionsförderungen verzichteten, da sie (die Höhe der Heimentgelte ausgenommen) keinen steuernden Einfluss auf die Infrastrukturentwicklung ausüben konnten. Das Marktmodell hat die Zahl der Einrichtungen und Dienste der Pflege deutlich erhöht. Über fein ziselierte Instrumente der Qualitätssicherung wurde einem Wettbewerb zulasten der Qualität entgegengetreten. Der gemeinsamen Selbstverwaltung wurde die Regie über die Spielregeln des Pflegemarktes zugewiesen.
Die Pflegeversicherung war und ist gesetzgeberisch eine Dauerbaustelle. Man hat manche Desiderate erkannt, etwa beim Pflegebedürftigkeitsbegriff, der 2017 pflegewissenschaftlich fundiert und für diskriminierte Gruppen von auf Pflege angewiesenen Menschen – insbesondere Menschen mit Demenz – geöffnet wurde. Korrekturen im Leistungsrecht, Aufnahme von Wohngemeinschaften, Leistungsdynamisierungen, aber auch Anpassung der Strukturen der Beratung – Pflegeberatung und Pflegestützpunkte – gehörten zu den kleinteiligen Reformschritten. Im „Maschinenraum“ des SGB XI wurde ständig gewerkelt, das zeigt allein die Anzahl der Änderungsgesetze zum SGB XI in den letzten 30 Jahren (insgesamt mehr als 90 Änderungen). Eine schon seit Langem geforderte grundlegende Reform, die auf sektorenfreie Versorgungskonzepte ausgerichtet ist und die kommunale Handlungsebene stärker betont, lässt auf sich warten. Das gilt auch für ein zukunftsfestes Finanzierungskonzept. Die Finanzierung der Pflegeversicherung ist ein Dauerproblem, zuletzt beschäftigte sich eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe der Bundesregierung mit unterschiedlichen Stellschrauben, aber für Lösungen braucht es politische Mehrheiten. Und wenn nicht endlich die verfassungswidrig entnommenen und noch nicht rückerstatteten Corona-Aufwendungen an den Ausgleichsfonds der Pflegekassen aus dem Bundeshaushalt zurückgezahlt werden, ist eine Beitragssatzanhebung zu erwarten. Auch das Thema Vermeidung pflegebedingter Armut ist nach 30 Jahren wieder aktuell. Die Sozialhilfequote steigt im Heimbereich auch nach der Begrenzung des Eigenanteils deutlich. Gerade in den ostdeutschen Bundesländern ist Pflegearmut politikrelevant. Es bedarf Lösungen, die nicht allein auf den stationären Bereich konzentriert werden dürfen, sondern das Gesamtsystem in den Blick nehmen. Das Zielbild lautet: sektorenfreie Pflege.
Womit man schon zur Einführung der Pflegeversicherung hätte rechnen müssen, sind Demografieeffekte. Die Babyboomer gehen in Rente. In den nächsten 10 Jahren scheiden überproportional viele beruflich Pflegende aus dem Beruf aus. Sie zu ersetzen, wird auch bei dem hohen Anteil von Zugewanderten unter den Pflegeauszubildenden und transnationalen Pflegekräften nicht möglich sein. Wir werden mit weniger Pflegefachpersonen mehr Pflegebedürftige zu versorgen haben. Ab den 2030er Jahren wird die Demografie auch die Zahl der auf Pflege angewiesenen Menschen steigen lassen. Dies verlangt nach einem kompetenzorientierten Einsatz von Pflegefachkräften – das Pflegekompetenzgesetz hat hier wichtige Impulse gesetzt, die hoffentlich in der nächsten Legislatur aufgegriffen werden. Aber auch neue Formen informeller Sorge und Pflege sind gefragt.
Schon jetzt zeigen sich deutliche Infrastrukturdefizite in der Langzeitpflege. Da hilft der mit der Pflegeversicherung eingeführte Markt (allein) nicht mehr. Auf die Effizienz des Gesamtsystems kommt es an. Um Planungsinstrumente wird man nicht umhinkommen und es müssen unter Einbeziehung der gesundheitlichen Versorgung – Stichwort: Krankenhausreform – regionale Antworten auf die Versorgung und Sorge von und auf Pflege angewiesener Menschen erarbeitet werden, möglichst mit der Bevölkerung vor Ort. Gefragt ist nach 30 Jahren Pflegeversicherung nicht weniger als ein Restart der sozialen, aber auch kulturellen Sicherung von Sorge und Pflege in einer Gesellschaft des langen Lebens. Bleibt zu hoffen, dass das Thema wie vor 30 Jahren zu einem potenziell wahlentscheidenden avanciert.
In seinem 2024 erschienenen Buch „Pflegenotstand? Eine Streitschrift“ identifiziert und analysiert Prof. Dr. habil. Thomas Klie die Dilemmata der Pflegeindustrie. Darin plädiert er für ein gemeinsames Engagement aller.




















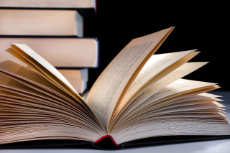
 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026
Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026
Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


