In wenigen Wochen startet die elektronische Patientenakte (ePA) für alle und schafft für Versicherte und Ärzte Zugriff auf wichtige Gesundheitsdaten. Doch das ist nur ein erster Schritt auf dem Weg zu einer echten digitalen Versorgung.

Ab 2025 erhalten Versicherte von ihrer Krankenkasse automatisch eine elektronische Patientenakte. Die Nutzung der ePA ist freiwillig, das heißt: Wer keine Akte möchte, kann der Anlage widersprechen. Hierüber haben die Krankenkassen ihre Versicherten vorab informiert. Und die Aufgeschlossenheit gegenüber der ePA ist groß: Die Widerspruchsquote liegt bisher nur im niedrigen einstelligen Bereich.
Die ePA bietet den Versicherten verschiedene Optionen für eine individuelle Nutzung – alles kann, nichts muss. Sie können der Einstellung oder Nutzung von Daten direkt während der Behandlung widersprechen und in der ePA-App sowie bei der Ombudsstelle ihrer Krankenkasse konkret festlegen, wer Zugriff auf welche Informationen hat.
Der Start der ePA für alle wird ab dem 15. Januar 2025 zunächst in den beiden Modellregionen Franken und Hamburg eingeläutet. Verlaufen die Tests erfolgreich, beginnt der bundesweite Rollout ab dem 15. Februar 2025. Kurz danach ist die ePA für alle dann deutschlandweit nutzbar.
Bedeutung der ePA für die Versorgung
In einem ersten Schritt stellen ärztliche und zahnärztliche Praxen sowie Krankenhäuser neue Arzt- und Befundberichte in die ePA ein, zum Beispiel nach Labor- oder Röntgenuntersuchungen. Wichtig ist, dass dies mit den jeweiligen Softwaresystemen möglichst aufwandsarm möglich ist. Zusätzlich können Daten aus früheren Untersuchungen ergänzt werden, wenn sie für die laufende Behandlung wichtig sind. Versicherte können darüber hinaus selbst persönliche Gesundheitsdaten in der ePA speichern, beispielsweise eigenständig geführte Tagebücher für Diabetes oder Blutdruckmessungen, wenn sie die ePA-App ihrer Krankenkasse nutzen. Eine weitere wichtige Datenquelle sind außerdem die Abrechnungsdaten, die die Krankenkassen auszugsweise in der ePA zur Verfügung stellen. Diese Übersicht umfasst ärztliche Diagnosen sowie Leistungen, die Versicherte beispielsweise von Arztpraxen oder Krankenhäusern, aber zum Beispiel auch von Physiotherapeuten in den letzten Jahren erhalten haben.
Neben diesen Dokumenten wird die ePA auch erstmals sogenannte strukturierte Daten enthalten: Die elektronische Medikationsliste wird automatisch aus den verordneten und ausgegebenen E-Rezepten zusammengestellt. Sie werden ab dem Zeitpunkt der Aktenanlage eingespielt, sobald neue Rezepte vorliegen. Auf diese Weise bekommen die Leistungserbringer einen guten Überblick über die bisherige Arzneimitteltherapie ihrer Patienten. Ab Juli 2025 sollen diese Daten auch durch weitere Informationen wie freiverkäufliche Medikamente und Informationen zur Arzneimitteltherapiesicherheitsprüfung (AMTS) ergänzt werden können. Ziel ist es unter anderem, Risiken durch Wechselwirkungen zukünftig schneller zu erkennen und damit die Versorgung besser und sicherer zu machen.
Insgesamt wird in den kommenden Jahren der Fokus bei der Weiterentwicklung der ePA vor allem darauf liegen, noch mehr Daten in strukturierter – und damit maschinenlesbarer – Form zu hinterlegen. Diese sogenannten Medizinischen Informationsobjekte sind unter anderem für Laborbefunde (voraussichtlich ab 2026), für Impfpässe und Messwerte aus Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) vorgesehen. Mit ihnen entstehen mittelfristig viele neue Möglichkeiten: Ärzte und Patienten können sich zum Beispiel Therapieverläufe einfach und schnell grafisch darstellen lassen. Durch die Verknüpfung verschiedener Informationen und den Einsatz von Algorithmen und Künstlicher Intelligenz (KI) können Ärzte bei ihren Behandlungsentscheidungen unterstützt und den Versicherten individuelle Gesundheitsempfehlungen gegeben werden. Nicht zuletzt sind strukturierte Daten auch Voraussetzung dafür, dass pseudonymisierte Informationen aus der ePA sinnvoll für Forschungszwecke genutzt und damit beispielsweise die Entwicklung neuer Therapieformen befördern können.
Damit ist der Start der ePA für alle ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einem stärker digitalen Gesundheitssystem, von dem vor allem die Patienten profitieren werden.




















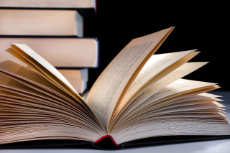
 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026
Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026
Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


