Die soziale Pflegeversicherung (SPV) steht vor großen Herausforderungen. In einer älter werdenden Gesellschaft ist sie wichtiger denn je und mit ihrem solidarischen Ansatz der „soziale Kitt“ unserer Gesellschaft. Die Politik ist mehr denn je gefragt, diesen wichtigen Sozialversicherungszweig zukunftsfest aufzustellen und eine solide Finanzbasis zu schaffen.
Die soziale Pflegeversicherung (SPV) gehört neben der Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung zum Wesenskern der sozialen Absicherung in Deutschland. Solidarität und Eigenverantwortung prägen ihre Grundsätze und rund 90 Prozent der Bevölkerung beteiligen sich über den gesetzlich festgelegten Beitragssatz an der Finanzierung der pflegerischen Versorgung von aktuell etwa 5,2 Millionen Pflegebedürftigen. Sie hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Betroffenen aus der Abhängigkeit der Sozialhilfe herausgenommen werden konnten, und hat damit auch die Sozialhilfe finanziell enorm entlastet. Nicht zuletzt trug sie dazu bei, ein bundesweites Versorgungsnetz von derzeit rund 16.100 Pflegeheimen und 15.400 ambulanten Diensten aufzubauen und finanziell und strukturell zu sichern.
Die aktuellen Herausforderungen dieses Sozialversicherungszweigs sind vielschichtig, allen voran steht die prekäre Finanzsituation. Zum Ende des Jahres 2024 wird der SPV ein Defizit von mindestens 1,5 Milliarden Euro prognostiziert, nächstes Jahr werden es vermutlich rund 3,5 Milliarden Euro sein. Damit wird der Mittelbestand Anfang 2025 deutlich unterhalb einer Monatsausgabe liegen und die Zahlungsfähigkeit des Ausgleichsfonds kann nur mühsam aufrechterhalten werden. Da bisher von der Politik leider viel zu lange nicht strukturell gegengesteuert wurde, bleibt nun eigentlich nur der kurzfristige Ausweg über Beitragssatzerhöhungen.
Diese sich zuspitzende Finanzlage kommt keineswegs überraschend. Der stetige und demografiebedingte Anstieg der Leistungsbezieherinnen und Leistungsbezieher, starke Leistungsausweitungen im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Pflegebegriffs, die einmalig hohe Zuführung in den Pflegevorsorgefonds und der seit 2024 ausgesetzte Bundeszuschuss in Höhe von einer Milliarde Euro sind nicht erst seit gestern bekannt. Und dennoch kommt die Politik hier nicht wirklich ins Handeln. Eine der bisher wenigen erkennbaren politischen Reaktionen war ein vom Bundeskabinett am 3. Juli 2024 beschlossener interministerieller Bericht zur zukünftigen Finanzierung der Pflege. Dieser beschreibt unterschiedliche Finanzierungsoptionen für die Pflegeversicherung und sollte als Kompass für politische Entscheidungen dienen. Allein passiert ist auf dieser Basis bis dato nichts. Oder sagen wir recht wenig, denn nachdem Anfang November zunächst ein Änderungsantrag zum Gesetz zur Stärkung der Öffentlichen Gesundheit das Licht der Welt erblickte, in dem einerseits der Beitragssatz um 0,15 Prozentpunkte angehoben werden sollte (+2,6 Milliarden Euro) und zudem nicht verbrauchte Bundesmittel für die Energiehilfezahlungen (etwa 1,5 Milliarden Euro) an Pflegeeinrichtungen im Ausgleichsfonds verbleiben sollten, zwang dann der Bruch der Ampel-Regierung den Minister dazu, allein auf das Instrument der Beitragssatzerhöhung (+0,2 Prozent) mittels Regierungsverordnung zu setzen. Das ist letztlich alles andere als eine strukturell angelegte Finanzlösung für die Zukunft, es verschafft der SPV aber eine kurze finanzielle Verschnaufpause für das Jahr 2025. Damit wird das eigentliche Problem mal wieder in die nächste Legislatur verschoben.
Wer pflegt uns morgen?
Auf der Versorgungsseite sind die Herausforderungen nicht eben trivialer, denn der stetig zunehmende Fachkräftemangel macht auch nicht vor dem Pflegesektor halt. Die Frage, wer uns in Zukunft noch pflegt, wird damit immer bedeutsamer. Ohne das Engagement der Mitarbeitenden in den Pflegeberufen sowie insbesondere der pflegenden An- und Zugehörigen wird die SPV in Zukunft ihre Aufgaben nicht mehr umfassend erfüllen können. Verschärft wird der Trend durch die demografisch bedingt stark wachsende Anzahl der Pflegebedürftigen. Allein durch die Alterung könnte die Zahl der Pflegebedürftigen nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts von 5,6 Millionen Ende 2023 bis zum Jahr 2030 auf etwa 6,1 Millionen und damit um über zehn Prozent steigen. Bis zum Jahr 2050 werden sogar 7,5 Millionen Pflegebedürftige erwartet.
Daher ist es begrüßenswert, dass die Bundesregierung mit dem vorliegenden Entwurf eines Pflegekompetenzgesetzes die Stärkung der Pflegekompetenz der Pflegefachpersonen in den Fokus genommen hat. Der Ansatz, dass diese zukünftig unter Berücksichtigung ihrer Qualifikation neben Ärztinnen und Ärzten selbstständig erweiterte heilkundliche Leistungen in der Versorgung übernehmen können, ist genau richtig. Der Beruf wird attraktiver und die Fachkunde der Fachkräfte effektiver genutzt. Ein Schritt in die richtige Richtung. Aber auch hier ist aufgrund des Koalitionsbruchs unsicher, wie es damit weitergeht.
Daneben wird es darauf ankommen, die pflegenden Angehörigen stärker zu unterstützen und zu befähigen. Fünf von sechs Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt und davon deutlich mehr als die Hälfte ohne Unterstützung durch professionelle Pflege. Gerade unter diesem Blickwinkel spielen Themen wie Stärkung der Pflegekompetenz sowie Einbindung in nachbarschaftliche und ehrenamtliche und kommunale Netzwerke eine wichtige Rolle. Zudem müssen die Leistungen möglichst unkompliziert und niedrigschwellig und ohne viel Bürokratie abrufbar sein. Dies vor allem auch deshalb, weil die zahlreichen Pflegeaufgaben, die von den An- und Zugehörigen übernommen werden müssen, ohnehin mit hohen körperlichen und mentalen Belastungen einhergehen. Das Leistungsrecht des SGB XI darf daher keinesfalls an Komplexität zulegen, Leistungen und Zugänge müssen vereinfacht werden.
Keine Angst vor digital
Die Digitalisierung nimmt in der Pflege einen immer höheren Stellenwert ein und sollte auch hier als Chance, Entlastung und notwendige Unterstützung begriffen werden. Mit Blick auf die knappen Personalressourcen liegen die größten Potenziale in der Entlastung von administrativen und bürokratischen Aufgaben. Hierzu zählt auch der Einsatz der elektronischen Patientenakte (ePa), der eine zentrale und leicht zugängliche Sammlung aller relevanten Patientendaten gewährt und die Effizienz und die Qualität der Versorgung gleichermaßen steigert (Verweis auf Seite 16). In diesem Sinne müssen auch die Möglichkeiten der Telepflege im Zusammenhang mit der anlassbezogenen Beratung von Pflegebedürftigen weiter ausgeschöpft werden. Insgesamt gilt es, präventive und gesundheitsfördernde Maßnahmen stärker in den Blick zu nehmen. Denn sowohl individuell als auch gesellschaftlich besteht ein hohes Interesse daran, gesundheitsförderliche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Selbständigkeit bei alten oder pflegebedürftigen Menschen frühzeitig und passgenau anzubieten.
Des Weiteren sind Pflege und Gesundheit auf viele Arten sehr eng mit den klimatischen Umweltbedingungen verbunden. Auf der einen Seite sind die Folgen des Klimawandels eine zunehmende Herausforderung für Pflegebedürftige und deren An- und Zugehörige. Hier gewinnt der Hitzeschutz eine immer wichtigere Bedeutung und stellt vor allem Menschen, die zu Hause pflegen und gepflegt werden, vor besondere Herausforderungen. Auf der anderen Seite muss sich auch der Pflegesektor durch nachhaltiges Handeln und einen ressourcenschonenden Einsatz seiner Verantwortung für unser Klima stellen. Digitale Lösungen sind auch hier gefragt, um Strom zu sparen oder Transportwege zu optimieren.
Blick nach vorne
Die aktuellen Herausforderungen in der SPV sind facettenreich. Finanzseitig ist unverzügliches politisches Handeln gefragt, aber auch im Hinblick auf die zahlreichen Versorgungsfragen müssen die Weichen gesetzgeberisch auf Zukunft gestellt werden. Gerade die Finanzprobleme sind hinlänglich bekannt und überschatten die inhaltlichen Debatten. Mit dem Bericht zur zukünftigen Finanzierung liegt seit Monaten ein umfassender Baukasten neutral beschriebener Handlungsoptionen auf den Tischen in Berlin. Die Politik ist nun gefragt, langfristig tragfähige Lösungen zu finden. Dabei ist mit Nachdruck darauf hinzuweisen, dass die SPV finanziell von gesamtgesellschaftlichen Aufgaben entlastet werden muss. Diese sind mit Bundes- und Landesmitteln und nicht über Beitragsmittel zu finanzieren. Dazu zählt die soziale Absicherung von pflegenden An- und Zugehörigen ebenso wie die Finanzierung von Ausbildungs- und Investitionskosten.
Der Solidaritätsgedanke im System der SPV sollte nicht weiter ausgehöhlt werden. Daher sollte man endlich den Mut haben, den Finanzausgleich zwischen privater und sozialer Pflegeversicherung politisch anzugehen. Die derzeitige Bevorzugung einkommensstarker Bevölkerungsgruppen in der privaten Pflegeversicherung ist doch nicht wirklich erklärbar und am Ende unsolidarisch.
Die Ersatzkassen stellen sich den drängenden Fragen zur Zukunft der Sozialen Pflegeversicherung ebenfalls und bereiten ein entsprechendes Positionspapier mit dem Titel „Gute Pflege – stabile Finanzen: Pflegeversicherung zukunftsfest ausgestalten“ vor, das in ihrem höchsten Gremium der Selbstverwaltung verabschiedet werden soll. Nun ist es an der Politik, eine solide und nach vorn gerichtete Grundlage für unsere Soziale Pflegversicherung zu schaffen.





















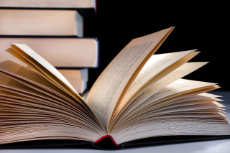
 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026
Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026
Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


