Trotz des vierjährigen Bestehens von Gesundheitsapps als neuer Art der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) sind Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) noch nicht gänzlich in der Versorgung angekommen. Wie kann die Akzeptanz gesteigert werden und an welchen Stellen bedarf es veränderter Rahmenbedingungen? Vorschläge zur Weiterentwicklung der DiGA haben die Ersatzkassen in einem Eckpunktepapier erarbeitet.

Seit dem 6. Oktober 2020 können Versicherte DiGA für verschiedenste Krankheitsbilder per Verordnung durch Vertragsärzt:innen und Psychotherapeut:innen oder direktem Antrag bei der Krankenkasse in Anspruch nehmen. Mittlerweile stehen über 50 Anwendungen zur Verfügung, die Ersatzkassen gaben mehr als 375.000 Freischaltcodes an ihre Versicherten aus. Dennoch etablierten sich DiGA bislang noch nicht. Die Erfahrungen der Ersatzkassen zeigen vielmehr, dass Korrekturen, vor allem im Hinblick auf Preisgestaltung, Zugang und Zulassung, vorgenommen werden müssen. Wie die Potenziale weiter ausgebaut werden können, zeigt ein Eckpunktepapier der Ersatzkassen.
Frühzeitig verhandelte Preise
Für eine faire und planbare Preisgestaltung fordern die Ersatzkassen die Abschaffung der Preisfreiheit im ersten Jahr der Zulassung bei DiGA. DiGA-Hersteller rufen Preise von über 2.000 Euro für die Nutzung einer Anwendung auf, die in keinem Verhältnis zum Patientennutzen stehen. Die Regelung um Höchstbeträge bei DiGA erzeugt derzeit keine Wirkung. Der vdek und seine Mitgliedskassen setzen sich daher für frühzeitig verhandelte Preise ein, die bereits mit Beginn der Zulassung gelten, um mehr Planungssicherheit für die Krankenkassen und DiGA-Hersteller zu erreichen. Dadurch werden auch insolvenzbedingte Ausfallrisiken für die GKV vermieden, wenn Rückforderungsansprüche der Krankenkassen von DiGA-Herstellern nicht mehr bedient werden können.
Darüber hinaus forcieren die Ersatzkassen die Einführung einer zweiwöchigen Testphase für Versicherte, um eine gerechtere Vergütung von DiGA zu erreichen. Hintergrund sind hohe Kosten für die Nicht-Nutzung von DiGA. Laut einer Auswertung der BARMER bricht mehr als jeder Dritte die Nutzung von DiGA vorzeitig ab. Durch ein Testen der DiGA können Versicherte ein Gefühl für die DiGA entwickeln und dann entscheiden, ob sie diese in ihren Alltag integrieren können.
Nutzungsmöglichkeiten stärken
Um mehr Akzeptanz für DiGA zu schaffen, sollten aus Sicht der Ersatzkassen auch die Nutzungsmöglichkeiten ausgebaut werden. Die Gesundheits-Apps sollten stärker in bestehende Behandlungsprozesse eingebunden werden, zum Beispiel über medizinische Leitlinien. Damit würden Ärzt:innen und Versicherte die Mehrwerte von DiGA unmittelbar erleben. Um den Zugang zu DiGA zu verbessern, sollte gleichzeitig auch die Förderung der digitalen Gesundheitskompetenz ausgebaut werden. Dadurch wird zum Beispiel mehr digitale Teilhabe erreicht, sodass auch Patient:innen mit wenigen Erfahrungen im Umgang mit digitalen Lösungen DiGA nutzen können. Die Ersatzkassen stellen ihren Versicherten unter anderem mit „Gesund digital“ bereits seit Längerem ein Angebot zur Förderung der digitalen Gesundheitskompetenz zur Verfügung, das mit leicht verständlicher Sprache und Erklärvideos explizit auch über DiGA informiert.
Mehr Transparenz
Weiterhin setzen sich die Ersatzkassen für eine stärkere Beteiligung der Selbstverwaltung im Zulassungsprozess der DiGA ein. Bislang sind Entscheidungen über Zulassungen und Streichungen von DiGA wenig transparent, denn das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) entscheidet im Fast-Track-Verfahren im Alleingang, ob eine App in das Verzeichnis aufgenommen wird. Vier Jahre DiGA zeigen, dass diese neue Art des Zulassungsverfahrens zwar den Vorteil einer schnellen Zulassung mit sich bringt, die Qualität der Zulassungen allerdings schwankt. Eine frühzeitige Einbindung der gemeinsamen Selbstverwaltung in den Zulassungsprozess reduziert Unklarheiten aufseiten der Krankenkassen und Leistungserbringenden und steigert dadurch die Akzeptanz von DiGA. Die Einbindung sollte aus Sicht der Ersatzkassen insbesondere für DiGA der Risikoklassen IIb gelten, bei denen das Gefahrenpotenzial höher ist.




















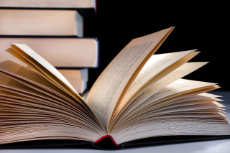
 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026
Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026
Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


