Der Bundesrat hat nach zähem Ringen nicht für eine Anrufung des Vermittlungsausschusses votiert, sodass die Krankenhausreform trotz oder vielleicht sogar wegen des Ampel-Bruchs in Kraft treten kann. Von vier Rechtsverordnungen und insbesondere dem Umsetzungswillen der Länder wird es abhängen, ob die Reform strukturelle Wirkung entfalten kann oder nicht; finanziell wirkt sie so oder so.

Mit der Krankenhausreform sollen dringende und notwendige Veränderungen für die Krankenhauslandschaft eingeleitet werden. Die Überlegungen der letzten zwei Jahre, die Krankenhausstrukturen bedarfs- und qualitätsorientiert zu reformieren, gehen durchaus in die richtige Richtung. Der Spagat, einerseits alle Krankenhäuser finanziell stützen zu wollen und andererseits eine Konzentrations- und Spezialisierung der Krankenhauslandschaft zu erreichen, wird schwer durchzuhalten sein. Vier Rechtsverordnungen, die der Zustimmung des Bundesrates bedürfen, gilt es nach den Vorgaben des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes (KHVVG) noch zu verabschieden. Erst dann ist das Reformvorhaben abgeschlossen, zumindest vorerst. Insbesondere die Pflege und Weiterentwicklung der Leistungsgruppen sowie die Ausgestaltung der Mindestvorhaltezahlen werden maßgeblich über den Umsetzungserfolg der Reform entscheiden.
Das Zielbild bisheriger Reformüberlegungen geht immer noch vom Wünschenswerten aus. Der demografische Wandel führt nunmehr für alle sichtbar zu einem Fachkräftemangel, der es unmöglich macht, alle bisherigen Krankenhausstandorte mit ausreichend Personal, insbesondere in den Nachtzeiten und an den Wochenenden, vorzuhalten. Er wird darüber hinaus in den nächsten Jahren auch zunehmend zu einer Schwächung der Wirtschaftsleistung führen. Insofern befinden wir uns immer mehr in einer Zeitenwende hin zur Ressourcenknappheit. Dies macht es mehr denn je erforderlich, sich auch im Rahmen der Krankenhausversorgung realitätsnah und praxistauglich vom Wünschenswerten weg, hin zum Machbaren zu orientieren. Dies erfordert eine andere Herangehensweise und andere Maßnahmen als die, die bislang erörtert wurden.
Das am Arbeitsmarkt verfügbare Fachpersonal für den Gesundheits- und damit ebenso für den Krankenhausbereich wird auch aufgrund steigender Bedarfe nicht ausreichend sein, um Sollvorgaben zu erfüllen. Umso wichtiger wird es in Zukunft sein, den bevölkerungsbezogenen Bedarf und gleichzeitig den verfügbaren Personalbestand zu ermitteln, um diesen möglichst effizient im Rahmen einer Ressourcenknappheit einzusetzen. Das Instrument der Personaluntergrenzen kann diesen Prozess unterstützen. Personalbedarfsvorgaben reflektieren in der augenblicklichen Situation nur ein Wunschdenken aus der Vergangenheit. Die angespannte Personalsituation erfordert eine sektorenübergreifende Betrachtung über die verschiedenen Leistungsbereiche hinweg. Folglich muss die künftige Krankenhausplanung in eine Gesundheitsversorgungsplanung eingebettet werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass wie im Bereich der Krankenhauspflege über die Fördermaßnahmen des Pflegebudgets Fachkräfte aus anderen Bereichen abgeworben und verschoben werden und sich damit der Fachkräftemangel auf andere Bereiche, etwa die Altenpflege, verschiebt und nicht behoben wird.
Die künftige Krankenhausplanung muss – ausgehend vom Bedarf und dem verfügbaren Gesundheitsfachpersonal – zum Ziel haben, die stationäre Grundversorgung in den ländlichen Regionen zu sichern und eine spezialisierte und konzentrierte Versorgung in den Mittelzentren und Ballungsgebieten zu fördern. Damit wird das gegenwärtige Nebeneinander von Fehl-, Über- und Unterversorgung abgebaut. Die Krankenhausplanung muss von den Ländern aktiv und zukunftsfähig umgesetzt und weiterentwickelt werden. Darauf aufbauend ist es erforderlich, dass die verfügbaren finanziellen Ressourcen zielgerichtet eingesetzt werden; die Krankenhausplanung und die Finanzierung müssen in ihrer Zielrichtung aufeinander abgestimmt sein. Werden Beitragsgelder hingegen mit der Gießkanne an alle Krankenhausstandorte gleich verteilt, werden die Kosten und damit die Beitragssätze weiter steigen, während die vorhandenen Versorgungsstrukturen zementiert werden.
Ambulantisierung erforderlich
Der Fachkräftemangel macht es zudem erforderlich, stationäre durch ambulante Behandlungen zu ersetzen. Da letztere sowohl von niedergelassenen Ärzten als auch von Krankenhäusern erbracht werden können, ist im Zeitalter des Fachkräftemangels eine effiziente Arbeitsteilung erforderlich. Dies erfordert auch das Bekenntnis darüber, wer welche ambulante Leistung wo, wann und zu welchem Preis erbringen darf. Wird dies beantwortet, kann die zweigleisige ambulante und stationäre Bedarfsplanung im Übrigen beibehalten werden. Werden diese Fragen wie bislang nicht beantwortet, führt dies zu einem sektorenübergreifenden Wettbewerb. Dieser Wettbewerb richtet sich jedoch nicht an der bestmöglichen Versorgung aus, sondern an dem knappen – zumeist ärztlichen – Fachpersonal. Die Forderung nach einem sektorenübergreifenden Wettbewerb führt kurz- bis mittelfristig zum Ausbau der doppelten Facharztschiene und langfristig zu Versorgungsungleichgewichten und Engpässen. Das Konstrukt der Leistungsgruppen sollte daher um diesen ambulant- stationären oder auch hybriden Bereich perspektivisch ergänzt werden.
Umsetzung kooperativ und mit Augenmaß
Das Prinzip der Leistungsgruppen wurde als Blaupause für die Krankenhausreform von Nordrhein- Westfalen (NRW) übernommen. Es sollte allerdings auch der Prozess der Umsetzung der neuen Krankenhausplanung übernommen werden. Krankenhausträger und Krankenkassen führen Vorverhandlungen durch, und die Ergebnisse werden dem Land vorgelegt, welches das Letztentscheidungsrecht hat. Sieht man sich die vorläufigen Ergebnisse aus NRW genauer an, erkennt man schnell, dass hier alle Beteiligten zusammen und nicht gegeneinander – wie man bislang im Rahmen des Reformprozesses auf der Bundesebene schnell den Eindruck gewinnen konnte – gearbeitet haben.
In NRW zeichnet sich bei derzeit noch nicht vollständiger und bereinigter Datenlage ab, dass knapp 20 Prozent der Anträge für die einzelnen Leistungsgruppen vom Land negativ beschieden wurden. In der Grundversorgung, insbesondere der Allgemeinen Chirurgie und der Inneren Medizin, liegt der Anteil der Negativbescheide bei unter sieben Prozent. Tendenziell steigt bei den Leistungsgruppen mit kleiner werdenden Fallzahlen im gesamten Land die Konzentration an. Insgesamt soll es auch zu einem Tausch von Leistungsgruppen der Krankenhäuser untereinander kommen. Eine reine Sogwirkung hin zu den großen Krankenhäusern der Schwerpunkt- und Maximalversorgung wird es folglich nicht geben. Die vielversprechenden vorläufigen Ergebnisse aus NRW sollten alle Länder motivieren, die neue Krankenhausplanung gemeinsam mit den Vertretern der Krankenhäuser und Krankenkassen und nicht im Alleingang umzusetzen.




















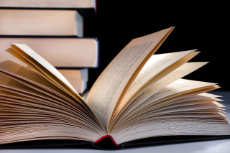
 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026
Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026
Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


