Eine aktuelle Studie der hkk zeigt: Kieferorthopädische Behandlungen sind oft teurer und länger als geplant – und nicht immer notwendig. Rund 40 Prozent der Behandlungen dauern zu lange, viele Kinder werden unnötig geröntgt, und einige von der Idealzahnstellung abweichenden Zahnstellungen würden sich auch ohne Behandlung korrigieren. Experten fordern nun klare Standards und eine Reform der Vergütungssysteme, um Eltern finanziell zu entlasten und überflüssige Eingriffe zu vermeiden.
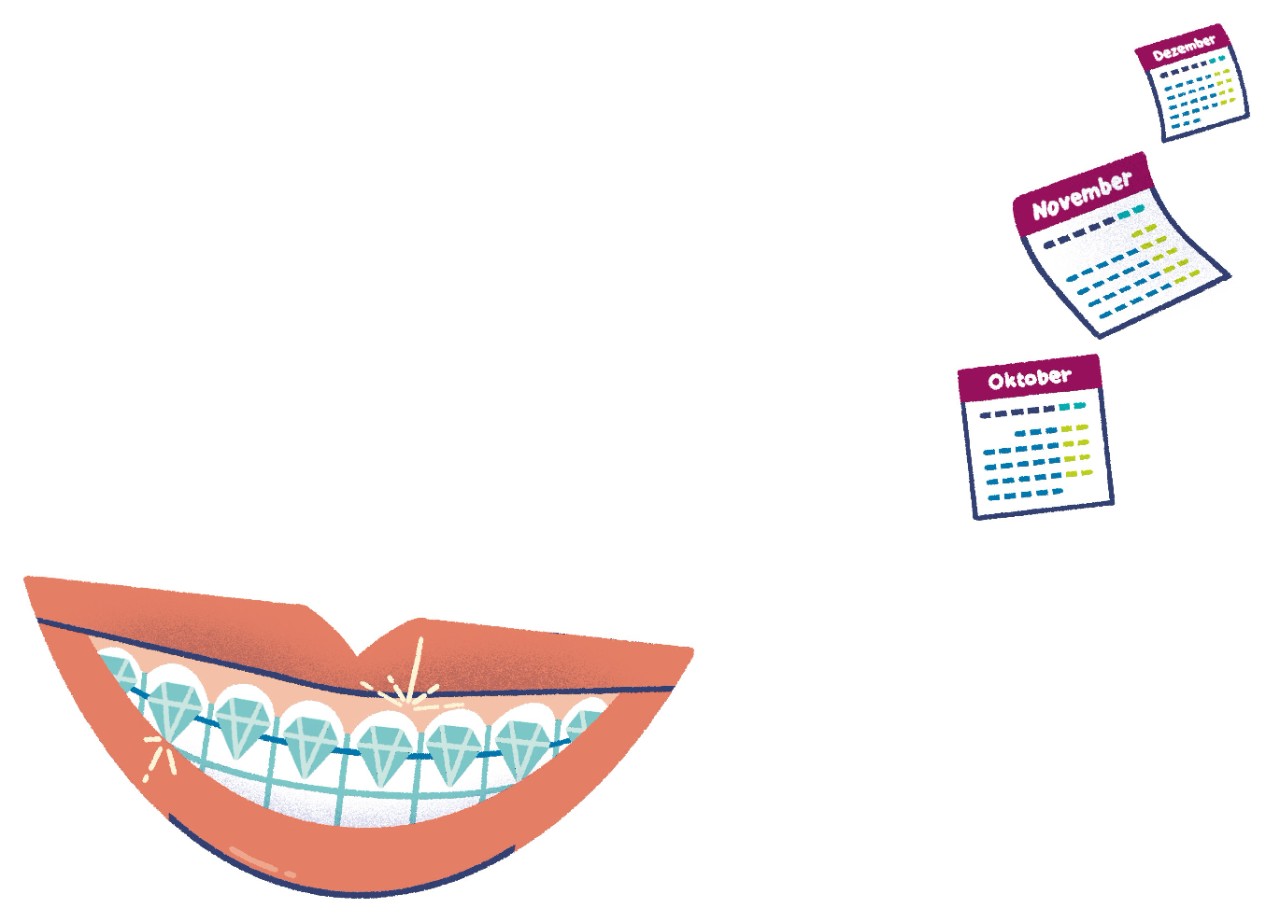
Eine von der hkk beauftragte Studie hat erstmalig die kieferorthopädische Behandlung von Kindern und Jugendlichen umfassend untersucht. Der Anlass: Es mangelte an aussagekräftigen Daten zu Art, Dauer und Erfolg dieser Behandlungen. Die Ergebnisse zeigen, dass das Thema dringender Aufmerksamkeit bedarf. Die Behandlungen sind nicht nur zu teuer und zu lang, sondern oft unnötig, da manche abweichende Zahnstellungen sich von selbst verbessern könnten.
Sozialwissenschaftler Dr. Bernard Braun und Kieferorthopäde Dr. Alexander Spassov analysierten 1.595 Behandlungsfälle. Der Großteil der Patienten, deren Behandlung formell abgeschlossen wurde, war bei Behandlungsbeginn zwischen 11 und 13 Jahren alt. Die häufigsten Einstufungen der kieferorthopädischen Indikationsgruppen (KIG) waren D4 (17,8 Prozent), K4 (16,9 Prozent) und M4 (14,2 Prozent). Diese Gruppen klassifizieren den Schweregrad von abweichenden Zahnstellungen. So steht D4 für einen Überbiss von vier bis neun Millimetern, K4 für einen einseitigen Kreuzbiss und M4 für einen Kreuzbiss im Frontzahnbereich mit einem Abstand von null bis drei Millimetern.
Die Diagnose erfolgte bei 82,9 Prozent der Patienten mittels einer Fernröntgenaufnahme – obwohl zahlreiche Studien belegen, dass diese Methode keinen zusätzlichen Nutzen bringt. Auch die Kosten für die Behandlung waren höher als geplant: Pro Patient wurden im Schnitt 2.710,86 Euro kalkuliert, doch die tatsächlichen Kosten beliefen sich nach Abschluss der Behandlung auf durchschnittlich 2.862,08 Euro.
Für die Behandlung an sich ist pauschal ein Zeitraum von vier Jahren (16 Quartale) vorgesehen. Unter den Teilnehmern, deren Behandlung innerhalb des Studienzeitraums (2018 bis Juni 2023) abgeschlossen wurde, betrug die durchschnittliche Dauer 2,4 Jahre. Die Studie zeigt jedoch, dass 39,2 Prozent der 2018 geplanten Behandlungen länger dauern. Die tatsächliche Behandlungsdauer liegt zwischen viereinhalb und fünfeinhalb Jahren, was für Eltern, die einen Eigenanteil von 20 Prozent zahlen müssen, finanzielle Nachteile bedeutet. Diese verlängerte Behandlungszeit hat auch monetäre Gründe: Eine längere Behandlung bedeutet für die Kieferorthopäden längere Einnahmensicherheit und oft zusätzliche Einnahmen.
Ein wesentlicher Faktor für die übermäßige Dauer ist die sogenannte Zwei-Phasen-Behandlung. Hierbei erhalten die Patienten zuerst eine herausnehmbare und anschließend eine festsitzende Apparatur. Studien legen jedoch nahe, dass diese Vorgehensweise unnötig ist. Eine alleinige Behandlung mit einer festen Apparatur liefert gleichwertige Ergebnisse und ist effizienter. Die durchschnittliche Behandlungsdauer von der ersten Kieferumformung bis zum Abschluss beträgt 2,6 Jahre. Wird die Behandlung ausschließlich mit einer festen Apparatur durchgeführt, reduziert sich die Dauer auf nur 1,8 Jahre – bei gleichem Ergebnis.
Hinweise auf Überversorgung gibt es auch bei Frühbehandlungen. Besonders bei den kieferorthopädischen Indikationsgruppen K (Kopfbiss, einseitiger oder beidseitiger Kreuzbiss) und M (Fehlstellung der Schneidezähne) zeigt sich, dass diese von der Idealzahnstellung abweichenden Zahnstellungen im Alter oft von selbst zurückgehen. Dies wirft die Frage auf, ob bei diesen Patienten tatsächlich eine frühe Behandlung notwendig ist. Statt sofort zu handeln, könne in vielen Fällen abgewartet werden, ob sich die Zahnstellung von allein bessert, schlussfolgern die Autoren. Falls keine Besserung eintritt, könnte die Behandlung ohne Nachteile für den Patienten auch zu einem späteren Zeitpunkt beginnen.
Die übermäßig lange Behandlungsdauer und die häufig unnötigen Eingriffe haben auch finanzielle Auswirkungen: Die geplanten Kosten werden um durchschnittlich 5,6 Prozent überschritten.
Daher empfehlen Braun und Spassov mehrere Reformen für die kieferorthopädische Behandlung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV): „Die pauschale Vergütung über 16 Quartale (vier Jahre) sollte abgeschafft und durch eine ergebnisorientierte Vergütung ersetzt werden.“ Statt der bisherigen Einzelleistungsvergütungen setzen sie auf indikationsspezifische Pauschalvergütungen. Zudem fordern sie klare diagnostische und therapeutische Standards, die genau festlegen, wann eine lose oder eine festsitzende Apparatur zum Einsatz kommt. Auch die routinemäßige Röntgendiagnostik, die oft ohne ausreichende Begründung erfolgt, sollte künftig strengeren Indikationskriterien unterliegen. Ein weiterer Vorschlag zur finanziellen Entlastung der Eltern ist die Abschaffung der 20 Prozent-Eigenanteil- Regelung. Stattdessen könnte ein System eingeführt werden, das absolute und frequenzlimitierte Zuzahlungen für jede erbrachte Leistung vorsieht. Dies würde die finanzielle Belastung der Eltern deutlich reduzieren.
Für die Zukunft bedeutet das, dass unabhängige Institutionen Entscheidungshilfen entwickeln sollten, die Eltern bei der Wahl der richtigen Behandlungsstrategie unterstützen. Ziel ist es, den Kindern und Jugendlichen die bestmögliche Versorgung zukommen zu lassen – jedoch ohne überflüssige Maßnahmen, unnötige Kosten und eine künstliche Verlängerung der Behandlungszeit.




















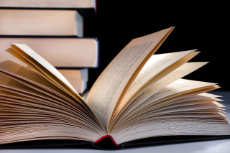
 Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen
Gesunde Lebenswelten – Ein Angebot der Ersatzkassen Landesbasisfallwerte 2026
Landesbasisfallwerte 2026 ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ICF – Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026
Beitragsbemessungsgrenzen und Beitragssätze 2026 Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen
Heilmittelversorgung – Verträge und Vergütungen


